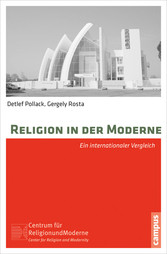
Religion in der Moderne - Ein internationaler Vergleich

von: Detlef Pollack, Gergely Rosta
Campus Verlag, 2015
ISBN: 9783593425207
Sprache: Deutsch
542 Seiten, Download: 4847 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Einführung
Joseph Story absolvierte die Harvard University als Zweitbester seines Jahrgangs. Mit 32 Jahren wurde er 1811 jüngster Richter aller Zeiten am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Er hielt es für seine Aufgabe, sich für die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz einzusetzen. Der junge Jurist war aber auch - ganz ein Mann seiner Zeit - ein glühender Verteidiger der Eigentumsrechte und als gebildeter Angehöriger der Oberschicht ein erfolgreicher Poet. Als Richter am Obersten Gerichtshof vertrat Joseph Story die Auffassung, dass es die erklärte Pflicht der Regierung sei, der göttlichen Offenbarung 'unter den Bürgern des Staates Geltung zu verschaffen und Förderung angedeihen zu lassen' (Koppelman 2004: 641). Die christliche Religion dürfe bei der Auslegung der Gesetze durchaus herangezogen werden, denn alle Glaubensrichtungen seien christliche, womit er wohl meinte protestantische. Den Glauben an die künftigen Belohnungen und Bestrafungen hielt er für die staatliche Rechtsausübung geradezu für unent-behrlich. Die Trennung von Kirche und Staat war zwar im First Amendment der amerikanischen Verfassung festgeschrieben. Der Grundsatz, dass dem Christentum eine bevorzugte Stellung im gesellschaftlichen Leben der USA zukomme, konnte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA jedoch unumstrittene Geltung beanspruchen und wurde auch von Joseph Story trotz seines Einsatzes für die Gleichbehandlung aller vor dem Gesetz nicht bezweifelt. Dieser Vorrang blieb dem Christentum in den USA bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erhalten. Noch 1892 stellte das Oberste Bundesgericht in einem einstimmigen Urteil fest: dass man 'im amerikanischen Leben, wie es sich in seinen Gesetzen, seiner Wirtschaft, seinen Sitten und seiner Gesellschaft bekundet, ein und dieselbe Wahrheit anerkannt findet, dass dies eine christliche Nation ist' (Church of the Holy Trinity vs. United States). Heute wäre kein Richter des Obersten Gerichtshofes mehr bereit, dem Christentum oder gar dem Protestantismus eine solche Vorzugsstellung ein-zuräumen.
Den Hinweis auf die christlich inspirierte Gesetzesauslegung des Joseph Story und die noch Ende des 19. Jahrhunderts durch das Oberste Bundesgericht festgeschriebene Bevorzugung des Christentums hätte man wohl noch vor kurzem als ein untrügliches Zeichen dafür genommen, wie stark sich die religiöse Landschaft in den USA in den letzten zwei Jahrhunderten geändert hat. Man hätte in den eingetretenen Veränderungen nicht nur eine Manifestation der religiösen Pluralisierung seit Beginn des 19. Jahrhunderts gesehen, als der Protestantismus noch das geistige Fundament der öffentlichen Diskurse in den USA bildete, sondern den religiösen Wandel der letzten 200 Jahre wohl auch als den klaren Ausweis ei-ner die Öffentlichkeit ebenso wie das Recht und die Politik umfassenden Säkularisierung interpretiert.
Von Säkularisierung wollen gegenwärtig allerdings nur noch wenige sprechen. Konfrontiert mit den klaren Zeichen einer die letzten zwei Jahrhunderte umfassenden rechtlichen Deprivilegierung des Christentums in den USA würden die meisten Religions- und Sozialwissenschaftler heute wohl nach Gegenbeispielen Ausschau halten und versuchen, vielleicht durch Verweis auf die Zunahme des Kirchenmitgliederbestands seit der amerikanischen Revolution, auf die geistlichen Impulse der Erweckungsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts, auf den politischen Erfolg der Moral Majority oder auch auf die hohe mediale Präsenz charismatischer Fernsehprediger, die Meistererzählung vom Bedeutungsrück-gang der Religion in der Moderne zu erschüttern. Die Infragestellung der Sä-kularisierungstheorie ist zu einer beliebten rhetorischen Übung geworden, und viele beziehen sich auf sie nur noch wie auf einen toten Hund (Stark 1999: 273; Miller/Yamamori 2007: 38; Pfleiderer/Heit 2013).
Die Kritik am Säkularisierungstheorem betrifft einmal die in ihm vorgenommene Entgegensetzung von Religion und Moderne bzw. von Tradition und Moderne, dann aber auch ihren evolutionären, fortschrittsgläubigen und eurozentrischen Charakter insgesamt. Besonders richtet sie sich gegen die Behauptung, dass Modernisierung unweigerlich zur Säkularisierung führe und Religion durch die Konsequenzen von Rationalisierung, Technisierung und funktionaler Differenzierung, durch Anhebung des Wohlstandsniveaus, Bildungsanstieg und Urbanisierung negativ betroffen sei. Kritik wird aber auch an der Verwendung eines institutionell verengten Religionsbegriffes, am Gebrauch eines homogenisierten Mo-dernebegriffs, an der Depotenzierung von Religion als bloßer abhängiger Va-riable sowie an der Idealisierung der Vergangenheit als 'golden age of faith' geübt (Warner 1993; Casanova 1994; Berger 1999; Stark/Finke 2000; Graf 2004; Beck 2008; Hellemans 2010).
Wer der Ablehnung der Säkularisierungstheorie empirische Daten entgegensetzt, die Tendenzen der Säkularisierung in modernen Gesellschaften zweifelsfrei belegen, sieht sich schnell dem Vorwurf ausgesetzt, er habe sich zu stark auf Indikatoren institutionalisierter Religiosität konzentriert. Im Zeitalter der Individualisierung lasse sich religiöser Wandel nicht mehr an konfessioneller Zugehörigkeit oder Kirchgang messen (Luckmann 1991; Harskamp 2005; Kennedy 2005; Knippenberg 2008; Knoblauch 2009: 17). Notwendig sei es vielmehr, auch Formen subjektiver Religiosität sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit zu schenken. Wer daraufhin auch den Glauben an Gott oder die religiöse Selbsteinschätzung als Indikatoren religiösen Wandels heranzieht und zeigt, dass diese Variablen bei einer langfristigen Betrachtung gleichfalls von Erosionstendenzen betroffen sind und - nebenbei bemerkt - zudem in einem statistisch nachweisbaren positiven Zu-sammenhang mit dem Kirchgang stehen, bekommt zu hören, dass Religion nach dem Niedergang des positivistischen Wissenschaftsverständnisses nicht mehr mithilfe standardisierter Methoden erfasst werden könne, sondern dass es dafür einer hermeneutischen und diskursanalytischen Herangehensweise bedürfe (Großbölting/Große Kracht 2010: 340). Waren es zunächst die falschen Daten, die Stirnrunzeln provozierten, so erregt nun schon die Tatsache Missbehagen, dass man überhaupt mit Daten arbeitet. Wer dann darauf verweist, dass sich Veränderungen im Zeitverlauf nicht feststellen ließen, wenn der Maßstab der Beurteilung nicht konstant gehalten werde, und dass die Messgrößen daher standardisiert zu sein hätten, der muss mit blanker Verachtung rechnen. Nach dem Ende der großen Erzählungen könne keine Metatheorie mehr universalistische Geltungsansprüche erheben, auch die Säkularisierungstheorie nicht. Diese sei allenfalls noch als Ausdruck des Selbstverständnisses der Epoche von Bedeutung, deren Entstehung sie sich verdanke, habe uns aber materialiter nichts mehr zu sagen (Asad 2003; Graf 2004: 96f.; Borutta 2005: 16; 2010: 347; Knöbl 2013: 78ff., 111). Vergeblich der Hinweis darauf, dass zwischen dem Entstehungskontext einer Aussage und ihrem Geltungsgrund zu unterscheiden sei. Töricht das Unterfangen, die Kritiker der Säkularisierungstheorie davon überzeugen zu wollen, sie hätten sich mit ihrer grundsätzlichen Abkehr von der Säkularisierungstheorie selbst in eine Meistererzählung verstrickt (so auch Ziemann 2009: 32; Haustein 2011a: 552). Die Kritiker der Säkularisierungstheorie lassen sich nicht irritieren. In selbst-gewissem Ton verkünden sie die Wiederkehr der Religion oder das Zeit-alter des Post-Säkularismus und setzen an die Stelle von Konvergenz- und Linearitätsannahmen Vorstellungen der historischen Kontingenz der Moderne oder behaupten die Kompatibilität der Religion mit der Moderne. Ihnen ist klar, was sie ein für alle Mal hinter sich lassen wollen. Nichts kann sie von ihrer entschiedenen Abkehr von Großtheorien, wie sie Modernisierungs- und Säkularisierungstheorien nun einmal darstellen, abhalten.
Gegenüber dieser entschlossenen Geste der Verabschiedung möchten die hier vorgelegten Analysen zwei Fragen offen halten: Wissen wir wirklich bereits, worin die dominanten Tendenzen des religiösen Wandels in modernen Gesellschaften bestehen? Und: Sind wir in der Lage, diese Tendenzen zu erklären? Die hier versammelten Analysen nehmen sich vor, eine deskriptive und eine explanatorische Frage aufzuwerfen: Sie wollen beschreiben, wie sich die soziale Signifikanz von Religion in ihren unterschiedlichen Facetten in modernen Gesellschaften verändert hat. Darüber hinaus geht es ihnen darum zu erklären, welche Faktoren und Bedingungen zu diesen Veränderungen beigetragen haben.
Dabei kann eine Analyse, wie sie hier vorgenommen werden soll, natürlich nicht darauf verzichten, auch säkularisierungstheoretische Aussagen auf ihre Berechtigung zu prüfen. Es ist völlig unstrittig, dass sich viele säkularisierungstheoretische Annahmen nicht aufrechterhalten lassen. Die Behandlung von Religion als ein Phänomen, das der Vormoderne angehört, die Behauptung, dass die Religion ihre politisch-öffentliche Bedeutung weitgehend eingebüßt und sich privatisiert habe, oder auch deterministische Linearitätsunterstellungen wird man aufgeben müssen. Ebenso dürfte es erforderlich sein, den eigendynamischen Potentialen sowie den Transforma-tions- und Selbstmodernisierungskapazitäten der Religion stärkere Beachtung zu schenken. Die notwendige Revision säkularisierungstheoretischer Annahmen sollte jedoch nicht a priori dazu führen, ihnen jegliches Er-klärungspotential abzusprechen. Die Kritik an der Entgegensetzung von Reli-gion und Moderne bzw. Tradition und Moderne, am Entwurf deterministischer Ableitungsmodelle und am Gebrauch homogenisierter Containerbegriffe steht in der Gefahr, in einen unkritischen Relativismus abzugleiten, der das Kontingente verabsolutiert, den Einzelfall zur einzigen Untersuchungseinheit aufwertet und die Herausarbeitung übergreifender Strukturen behindert (Wohlrab-Sahr 2013). Ob Religion und Moderne vereinbar sind, ob Tradition und Moderne Gegensätze bilden, ob die interne Vielfalt der Moderne gegenüber ihrer Einheit überwiegt, ob es verallgemeinerbare Muster und Entwicklungstendenzen gibt, darf nicht ideo-logisch vorentschieden, sondern muss historisch und empirisch untersucht wer-den. Sowohl die produktiven Wirkungen religiöser Gemeinschaften, Praktiken und Vorstellungen als auch ihre Abhängigkeit von äußeren Umständen, sowohl die Vereinbarkeit von Religion und Moderne als auch die zwischen ihnen lie-genden Spannungen, sowohl die historische Kontingenz religiöser Verände-rungsprozesse als auch ihre Regelhaftigkeit müssen in Betracht gezogen werden. Die sozialwissenschaftliche Strukturanalyse und die kulturgeschicht-liche Interpretation der Religion sollten nicht in ein Ausschließungsverhältnis zueinander gebracht werden. Vielmehr käme es darauf an, Chancen ihrer Vermittlung auszuloten (vgl. Kocka 2008).
Ein solcher Vermittlungsversuch ist schon deshalb angeraten, da eine auf Exklusion setzende wissenschaftliche Analyse das Ausgegrenzte in der Regel nicht zum Verschwinden zu bringen vermag und das, wovon sie sich scharf abgrenzt, häufig als Unbegriffenes in ihren Gegenstandsbereich wieder zurückkehrt (Derrida 1967: 430). Es überrascht daher kaum, dass sich säkularisierungstheoretische Argumentationen auch bei erklärten Gegnern der Säkularisierungstheorie finden. Entschieden wenden sie sich von säkularisierungstheoretischen Annahmen ab und müssen dann feststellen, dass sie ohne sie nicht auskommen können, wenn sie nicht jede Erklärung schuldig bleiben wollen. Selbst einem so scharfen Kritiker der Säkularisierungstheorie wie Peter van Rooden (2004a: 21) fällt zur Erklärung der in den 1960er Jahren einsetzenden dramatischen Dechristianisierung in den Niederlanden nichts anderes ein, als auf 'the sudden growth in wealth and the emergence of a mass consumer society' zu verweisen. Auch Hugh McLeod - einer der besten Kenner der modernen Religionsgeschichte in Europa - vertritt trotz aller verbalen Distanzierungsversuche letztendlich eine säkularisierungstheo-retische Position. Er weist zwar zunächst die von der Säkularisierungstheorie aufgestellten Globalthesen über den Zusammenhang von Industrialisierung, Urbanisierung und Wohlstandsanhebung auf der einen und Entkirchlichung auf der anderen Seite zurück und spricht der Säkularisierungstheorie die explanatorische Kraft ab (McLeod 1997; 2007: 16); dann aber macht er doch 'the impact of affluence' als den 'most important' Faktor der religiösen Krise der 1960er Jahre aus (McLeod 2007: 15). Bei aller verbalen Abgrenzung bleibt die neuere Zeitgeschichtsschreibung der Säkularisierungsthese oft auf eine merkwürdig unreflektierte Weise verhaftet (vgl. auch Damberg 2011: 30f.).
Statt ihrer Verabschiedung ist daher die kritische Auseinandersetzung mit der Säkularisierungstheorie geboten. Der Hinweis auf ihre Entstehungsbedingungen hilft dabei wenig. Auch wenn die Säkularisierungstheorie ein aus der Aufklärung stammendes eurozentrisches 'concept of modernity' sein sollte, so Callum Brown (2003: 39f.), oder ein in den Kulturkämpfen des 19. Jahrhunderts entstandenes grand récit der westlichen Moderne (Borutta 2005: 16, 2010) oder eine sich den spezifischen Umständen der 1960er Jahre verdankende Meistererzählung (Kippenberg 2007: 50), besagt das noch nichts über die Gültigkeit ihrer Annahmen. Falsifizieren lassen sich diese nur auf der Grundlage empirischer Fakten.
Eigentlich sollte die empirische Fundierung soziologischer oder historischer Aussagen unter Geistes- und Sozialwissenschaftlern eine Selbstverständlichkeit sein. Wie ein Blick auf die Arbeiten von Thomas Luckmann, Hans Joas, Talal Asad, Peter L. Berger oder Grace Davie zeigt, meinen jedoch nicht wenige Religionssoziologen, ohne einen systematischen Bezug auf empirische Daten auskommen zu können. In der Religionssoziologie hat sich eine Art armchair sociology etabliert, die zwar in der Lage ist, interessante und durchaus plausible Thesen aufzustellen, aber wenig Bedarf dafür sieht, diese auch empirisch zu testen. Auch Antonius Liedhegener (2012: 489) beklagt, dass sich 'die Religionssoziologie [...] - unbeschadet der Prominenz säkularisierungstheoretischer Theoreme - bis in jüngste Zeit nie ernsthaft für die empirische Überprüfung der behaupteten langfristigen Säkularisierung interessiert' hat.
Die empirische Fundierung soziologischer Aussagen ist freilich weitaus vor-aussetzungsvoller als so manch einer meint, der sich sozialwissenschaftlicher Daten bedient. Zur empirischen Fundierung soziologischer Aussagen reicht es keineswegs aus, gelegentlich empirische Forschungsergebnisse heranzuziehen, um mit deren Hilfe eine These zu stützen oder zu erschüttern. Ein selektiver Gebrauch empirischer Daten bleibt instrumentalisierbar. Oft dient er lediglich dazu, sich in Behauptungen, die unabhängig von der empirischen Arbeit gewonnen wurden, bequem einzurichten und sie gegen Infragestellungen abzuschirmen. Säkularisierungstheoretiker etwa lieben es, auf fallende Kirchgangsraten hinzuweisen, um den Bedeutungsrückgang von Religion zu belegen, Kritiker der Säkularisierungstheorie hingegen bevorzugen den Verweis auf das gestiegene Interesse an Esoterik, Spiritualität und Pilgerfahrten als Indizien für den Bedeutungsgewinn von Religion, und beide mögen sich in ihren Deutungen durch die beigebrachten Beweise bestätigt sehen. Empirische Evidenz für eine These lässt sich jedoch nicht durch Einzelnachweise erbringen, sondern nur dadurch, dass man sie auf eine breite empirische Grundlage stellt und abwägt, welche Quellen gegen und welche für sie sprechen. Die Empirie muss die Chance haben, eine aufgestellte These zu Fall zu bringen. Deshalb ist es erforderlich, das in Frage stehende Phänomen in seiner Gesamtheit in Blick zu nehmen und alle seine wesentlichen Merkmale der empirischen Analyse auszusetzen. Sich allein auf Kirchgangsraten oder allein auf Esoterikmessen zu verlassen, wenn es darum geht, Prozesse des re-ligiösen Wandels zu untersuchen, würde auf eine einseitige Verzerrung des Ge-genstandsbereichs hinauslaufen. Nur wenn den Analysen ein umfassender und trennscharfer Religionsbegriff zugrunde gelegt wird, der klar stellt, was in den als Religion definierten Bereich fällt und was nicht, ist es möglich zu erkennen, ob die soziale Signifikanz von Religion gestiegen oder gesunken oder in etwa gleich geblieben ist. Andernfalls besteht die Gefahr, Nebenaspekte überzubewerten und Hauptaspekte zu vernachlässigen.
Theoretische Überlegungen sind aber auch deshalb unausweichlich, da sich die Wirklichkeit nicht im Direktzugriff erfassen lässt. Niemals ist es möglich, die Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit empirisch einzufangen. Immer sind unsere Beobachtungen standpunktabhängig. Kulturelle Kontextbedingungen, politische Interessen, wissenschaftsstrategische Abgrenzungen drängen sich, ob wir das wollen oder nicht, in den Erkenntnisprozess und beeinflussen ihn mit. Empirisch gewonnene Daten sind mithin nicht als solche aussagekräftig. Bei ihnen handelt es sich stets um hergestellte Fakten und interpretierte Wirklichkeiten, um sinnhafte Rekonstruktionen, die nicht unabhängig von kategorialen und theoretischen Vorannahmen produziert werden können. Schon die Entscheidung darüber, welche Fakten zählen sollen und welche nicht, fällt auf der theoretischen Ebene. Es ist die Theorie, die festlegt, was wir überhaupt beobachten können, sagt Albert Einstein. Theoretische Überlegungen sind daher für die empirische Arbeit nicht nur insofern unumgänglich, als sie den Gegenstand in seinen wesentlichen Merkmalen bestimmen und eingrenzen, sondern auch insofern, als nur sie es erlauben, die richtigen analytischen Fragen zu stellen und herauszuheben, welche Phänomene von Belang sind und welche nicht. Sie geben den Rahmen ab, der über die Signifikanz aufgedeckter Fakten und Zusammenhänge entscheidet und sogar erklären kann, welche Bedeutung es hat, wenn sich erwartete Zu-sammenhänge nicht nachweisen lassen. Nur allzu oft gehen Empiriker jedoch von Fragen aus, die ihnen die verfügbaren Daten zu beantworten erlauben, und legen sich die theoretischen Annahmen so zurecht, dass sie durch die verfügbaren Daten geprüft werden können. Auch ein pragmatischer Umgang mit Theorieannahmen schließt die Gewinnung interessanter und relevanter Forschungsergebnisse nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit, zu überraschenden Erkenntnissen zu kommen, steigt allerdings, wenn empirische und theoretische Arbeit strenger voneinander unterschieden werden und so die Chance haben, sich wechselseitig zu stimulieren und zu korrigieren.
Die hier vorgelegten Studien enthalten sich einiger modischen Trends, die die Religionsforschung in letzter Zeit mehr und mehr erfasst haben. So verzichten sie auf die Bevorzugung qualitativer Forschungsergebnisse gegenüber quantitativen. Die qualitative Religionsforschung tritt mit dem Anspruch auf, die interessanteren, die tieferen, die relevanteren Erkenntnisse zu liefern. In einem ergebnisoffenen Forschungsprozess erkunde sie, so wird behauptet, das religiöse Feld, ohne durch standardisierte Methoden bereits auf Hypothesen und erwartbare Ergebnisse festgelegt zu sein. Auf diese Weise erziele sie innovativere Erkenntnisse und dringe auch zu einem differenzierteren Verstehen der Phänomene vor, dass diese nicht auf bloße Häufigkeiten reduziere, sondern in der Lage sei, ihre Tiefengrammatik zu erfassen. Richtig daran ist, dass sich soziologische Analyse nach dem cultural turn nicht mehr mit bloßen Häufigkeitsauszählungen begnügen kann und auch der Aufweis statistischer Korrelationen nicht mehr hinreichend ist. Der sozialwissenschaftlichen Arbeit muss es vielmehr darauf ankommen, die hinter den Häufigkeitsverteilungen und statistisch nachweisbaren Zusammenhängen liegenden Sinnmuster zu erhellen, die Weltinterpretationen der Akteure und ihr Selbstverständnis zu verstehen, ihre Weltdeutungsschemata und Diskursuni-versen. Die Rekonstruktion der Bedeutungsebene des Sozialen ist unverzicht-bar. Die Deutungsmuster der Akteure können aber nicht das Ziel der soziolo-gischen Analyse sein, sondern allenfalls ihr Ausgangspunkt. Sie müssen ins Verhältnis gesetzt werden zu ihren Praktiken, die von ihren Weltbildern und Selbstzuschreibungen zwar beeinflusst werden, von diesen aber durchaus abweichen können und daher aus ihnen nicht einfach ableitbar sind. Sie müssen außerdem bezogen werden auf die sozialstrukturellen, politischen, ökonomischen und rechtlichen Kontextbedingungen, die das Handeln der Individuen gleichfalls prägen, auch wenn sie zuweilen gleichsam im Rücken der Handelnden liegen und von ihnen diskursiv nicht eingeholt werden können.
Tatsächlich erweisen sich qualitativ gewonnene Forschungsergebnisse, sofern sie nicht unter Verwendung einer strengen Methode systematisch erzeugt werden, häufig gerade als wenig verlässlich, als partikularistisch, als wertend und als intransparent. Oft sind sie nicht auf wissenschaftlich nachvollziehbarer Basis gewonnen und daher intersubjektiv nicht überprüfbar. Obwohl sie nicht repräsentativ sind, nehmen sie nicht selten auf der Grundlage von wenigen Fällen, manchmal auch nur von einem einzigen Fall weitreichende Verallgemeinerungen vor und stellen gewagte Thesen auf. Was zum Beispiel besagt es, wenn ein Historiker einen Zeitzeugen der religiösen Veränderungen, wie sie sich etwa in der Bundesrepublik der 1950er Jahre vollzogen haben, mit der zufällig ausgewählten Aussage zitiert, dass alles bröckelt und rieselt? Wofür steht diese Aussage, welchen Stellenwert hat sie? Das bleibt innerhalb des qualitativen Untersuchungsdesigns unklar und muss in diesem Kontext unklar bleiben. Zudem sind qualitative Forschungsergebnisse oft nicht wertfrei, sondern es mischen sich subjektive Vorlieben und Abneigungen in die Analyse. Und schließlich argumentieren sie häufig auch nicht unter Einbeziehung aller relevanten Faktoren, sondern tendieren zur ein-seitigen Übersteigerung partikularistischer Gesichtspunkte, die nicht selten auf-grund starker theoretischer Vorannahmen gewonnen wurden. Dass Vorannah-men und Vorurteile den Gang der Forschung bestimmen, trifft eher auf quali-tative als auf quantitative Arbeiten zu. Manchmal liegen in der qualitativen Forschung theoretische Vorentscheidungen und empirische Forschungsergeb-nisse so nah beieinander, dass geradezu ein argumentativer Kurzschluss entsteht.
Zugleich werden von den Vertretern qualitativer Ansätze immer wieder ab-wertende Urteile über quantitativ vorgehende Analysen abgegeben, die nicht selten deren Spezifik verfehlen. Ohne tieferes Verständnis für die Logik statistischer Erhebungen und zuweilen sogar ohne überhaupt ein ernsthaftes Bemühen um ein solches wird quantitativen Ansätzen der Sozialwissenschaften pauschal ein Mangel an Einfühlungsvermögen, ein Denken in holzschnittartigen Kategorien, eine reduktionistische Wirklichkeitssicht und stupide Fliegenbeinzählerei vorgeworfen. Mit einem schwer nachvollziehbaren Anspruch auf methodologische Überlegenheit wird die quantitative Sozialforschung als ein Feld charakterisiert, auf dem sich offenbar nur noch Narren tummeln. Wenn etwa kirchenstatistische Erhebungen als ein bloßes ?Zählen der Köpfe?, als die Einsperrung hochindividueller und hybrider Religionsformen in ?Entweder-Oder-Kategorien? sowie als eine Form der Wirklichkeitsmanipulation behandelt werden, in der sich mehr die Po-sitionierung derjenigen, die die Daten sammeln und auswerten, als die mit den Daten bezeichneten Phänomene ausdrücken, dann ist die Grenze des wissen-schaftlich Vertretbaren überschritten. Statistische Erhebungen haben den Vor-zug, dass sie in der Lage sind, die Ebene der handelnden Individuen und die der Gesellschaft miteinander zu verklammern. Taufstatistiken zum Beispiel, so simpel sie zunächst erscheinen, sagen etwas aus über sich wandelnde Taufmotive der Individuen und stellen zugleich eine Zusammenfassung individueller Entscheidungen zu gesellschaftlichen Trends dar. Typisch für die standardisierte Erfassung kirchlicher Praktiken ist darüber hinaus nicht nur ein Denken im Dual von Entweder-Oder, sondern auch in den Kategorien von Wie und Warum. In Taufstatistiken, um bei dem Beispiel zu bleiben, wird nicht nur die Taufrate erfasst, sondern auch das Alter der Täuflinge. Ob man als Kind auf Veranlassung seiner Eltern getauft wird oder sich als Erwachsener aufgrund seiner eigenen Entscheidung taufen lässt, ist ein qualitativer Unterschied. Auch lassen Taufstatistiken Aussagen über den familiären Hintergrund des Getauften zu, etwa über die konfessionelle Homogenität der Eltern des Täuflings, ihren sozialen Status, ihr Bildungsniveau, ihre regionale Herkunft und so weiter, so dass sich verändernde Taufraten auch Aussagen über die sozialstrukturellen Umstände religiöser Veränderungen erlauben.
Und wenn behauptet wird, dass statistische Erhebungen mehr über den sagen, der sie anfertigt, als über das, was mit ihnen erfasst werden soll, dann kommt dem empirischen Nachweis überhaupt keine Geltung mehr zu. Dann ist die empirisch begründete Aussage mit der Beliebigkeit des freien Assoziierens und mit der Willkür persönlicher Interessen gleichgesetzt. Merkwürdig ist freilich, dass die, die die Statistik so offensichtlich verachten, ihre Ergebnisse, wenn sie ihnen passen, dann doch immer wieder gern heranziehen.
Einer solch willkürlichen Benutzung der Empirie gegenüber bestehen die hier angestellten Analysen auf der Vetokraft empirischer Daten, an denen plausible Vermutungen auch scheitern können. Selbstverständlich handelt es sich bei ihnen stets um hergestellte Daten. Und selbstverständlich bedürfen die mit Hilfe quantitativer Methoden gewonnenen Erkenntnisse ebenso der sinnverstehenden Interpretation wie die qualitativ erhobenen Einsichten. Es ist völlig unstrittig, dass auch die mit Hilfe repräsentativer Erhebungen und standardisierter Methoden produzierten Daten die Wirklichkeit nicht objektiv abbilden. Sie haben jedoch den Vorzug, dass sich ihre empirische Evidenz intersubjektiv kontrollieren und daher gegebenenfalls auch in Frage stellen lässt. Wenn es wie hier darum geht, Prozesse des religiösen Wandels zu rekon-struieren und internationale Vergleiche anzustellen, dann ist die Benutzung standardisierter Verfahren geradezu geboten. Nur wenn die Maßstäbe des Vergleichs, handele es sich nun um zeitliche oder regionale Vergleiche, gleich bleiben, können historische Veränderungen und regionale Unterschiede erfasst werden. Die Erkenntnis von Varianz setzt einen einheitlichen Maßstab voraus. Der Gebrauch quantitativer Methoden ergibt sich insofern zwangsläufig aus den diese Untersuchung leitenden Fragestellungen. Die Heranziehung qualitativer Daten ist damit natürlich nicht ausgeschlossen. Da sie für die Bearbeitung der leitenden Fragestellungen nur bedingt geeignet sind, kommt ihnen im Rahmen unserer Untersuchung allerdings nur ein sekundärer Wert zu.
Ebenso wenig wie die hier vorgelegten Studien allein qualitativen Forschungsmethoden vertrauen, folgen sie dem modischen Interesse an Entdifferenzierungsphänomenen, Entgrenzungen, Hybriden, Ambivalenzen, Paradoxien, Ungleichzeitigkeiten und Synkretismen. Das poststrukturalistische Denken bestreitet die Möglichkeit, Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster erkennen zu können und behauptet stattdessen die Inkommensurabilität des Wirklichen. Es löst das Wirkliche in Diskurse über die Wirklichkeit auf, Strukturen in Praktiken und allgemeingültige Aussagen in die Kontingenz des einzelnen Falls. Ihm geht es um die Destruktion bisher erworbenen Wissens, nicht um die Gewinnung neuer Erkenntnis. Wo bislang Grenzen und Zäsuren wahrgenommen wurden, da werden nun Kontinuitäten behauptet; wo man bisher von Einheiten ausging, da entdeckt man nun interne Differenzen und Brüche. In dem Versuch, erreichte Einsichten zu Fall zu bringen und durch Umkehrung zu überbieten, lagert es sich parasitär an diese an, bleibt aber vage und unterbestimmt in dem, was es stattdessen zu sagen hat. Während brave Wissenschaftler froh sind, wenn es ihnen gelingt, eine schmale Lichtung in das Dickicht der Wirklichkeit zu schlagen, bezieht der postmoderne Denker Befriedigung vor allem daraus, die Lichtung wieder einzureißen und erneut ins Zwielicht zu tauchen. Die postmoderne Begeisterung für unscharfe Grenzen kann distinkte Begrifflichkeiten jedoch nicht ersetzen. Vielmehr werden Unschärfen, Grenzverwischungen, Entdifferenzierungen, fließende Übergänge als solche überhaupt erst sichtbar, wenn man die Grenzen bestimmt, die an-geblich überschritten oder zum Verschwinden gebracht werden. 'Wir brauchen allgemeine Begriffe,' erklärt Friedrich Wilhelm Graf (2004: 237), 'um das re-ligiöse Feld strukturieren und von anderen Feldern abgrenzen zu können. [...] Es geht [...] nicht um einen funktionalistischen, ubiquitär verwendbaren Begriff der Religion. Doch ist das kulturell Besondere oder Individuelle nur dann zu beschreiben, wenn uns allgemeinere Begriffe zur Verfügung stehen, mit denen sich die spezifische Differenz dieses Besonderen erfassen lässt.' Auch die Überschreitung der Struktur bedarf der Struktur, um als solche erkennbar zu sein.
Ebenso sehen die hier versammelten Studien davon ab, Religionsgeschichte und -soziologie unter den Gesichtspunkten der Globalgeschichte zu betreiben. Auch wenn religiöse Gemeinschaften, zum Beispiel die katholische Kirche, oft global agieren, sind die Bedingungen, unter denen ihre Aktionen stattfinden, lokal und national zumeist so verschieden, dass sie innerhalb ihrer jeweiligen regionalen Kontexte analysiert werden müssen. Es ist durchaus nicht richtig, dass hinter allen regionalen Veränderungen transnationale Prozesse stehen. Inglehart hat gezeigt, dass nationale Unterschiede auf dem religiösen Feld trotz der unübersehbaren Globalisierungsprozesse nach wie vor hoch bedeutsam sind. Katholiken und Protestanten in den Niederlanden zum Beispiel weisen in ihren Werthaltungen stärkere Ähnlichkeiten auf als Katholiken, die in den Niederlanden und in traditionell katholischen Ländern wie Spanien oder Italien leben (Inglehart/Baker 2000: 37). Auch wenn man sich etwa die religiösen Kulturen in Polen und Tschechien vor Augen führt, die, obwohl die beiden Länder geographisch unmittelbar nebeneinander liegen und katholisch geprägt sind, kaum Gemeinsamkeiten besitzen, leuchtet sofort ein, dass man der Besonderheit dieser Kulturen nur mit einem Ansatz gerecht zu werden vermag, der nationalstaatliche Differenzen nicht außer Acht lässt. Die globalisierungsgeschichtliche Kritik am methodologischen Nationalismus droht zu einem methodologischen Globalismus zu werden (Spohn 2006). Dass die Vorstellung paralleler Entwicklungen aufgegeben werden muss, dass alle Regionen miteinander verwoben sind (entangled), dass in Wirtschaft, Politik, Sozialstruktur, Elitenbildung nur noch globale Kräfte am Werke sind und die Weltsystemebene die Existenzbedingungen für alle regionalen Entwicklungen vorgibt, ist ein Mythos (Hirst/Thompson 1998). Die Nationalstaaten sind nach wie vor entscheidende Akteure in Weltwirtschaft und Weltpolitik (Pohlmann 2006: 170). Trotz unübersehbarer Globalisierungstendenzen bleiben länder- und kulturspezifische Ordnungsmuster einflussreich (Blossfeld 2001: 240ff.; Mayer 2001; Streeck 2001).







