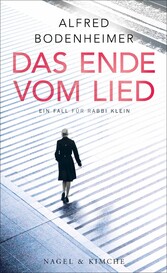
Das Ende vom Lied - Roman

von: Alfred Bodenheimer
Nagel & Kimche, 2015
ISBN: 9783312006632
Sprache: Deutsch
208 Seiten, Download: 1336 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1
Liebe Elisabeth,
wenn Du mich heute hättest sehen können! Zum ersten Mal wieder im weißen Kittel unterwegs, das Stethoskop in der Tasche.
Den ganzen Tag wandelte ich wie auf Wolken und schwankte zwischen Lachen über das wiedergewonnene Glück, in einem richtigen, wenn auch klitzekleinen Krankenhaus Patienten behandeln zu dürfen, und Weinen in Trauer um Dich, mit der ich das nicht mehr teilen darf.
Wie ich Dir schon geschrieben habe, steht mir noch ein langer Weg bevor – die Ausbildung zum Traumatologen wird noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich spüre das Vertrauen von Doktor Fueter, und er hat heute, als wir uns im Korridor begegneten, wiederholt, dass er sich darauf freut, hier einmal eine Abteilung für Traumatologie stehen zu sehen, deren Leiter ich wäre. Er rechnet ja damit, dass in wenigen Jahren wieder Touristen hierher zum Skilaufen kommen. «Da werden dann schon genug Arm- und Beinbrüche anfallen, machen Sie sich keine Sorgen», hat er mir aufmunternd gesagt, mit seinem breiten Akzent. Diese Schweizer pflegen zuweilen einen eigenartigen Pragmatismus.
Ich sinke jetzt ins Bett. Dieser Tag mit all seinen neuen Gefühlen und Aufgaben war doch sehr ermüdend. Wie immer denke ich an Dich in meiner engen Kammer, die ich in den nächsten Wochen durch eine bequemere Wohnung zu ersetzen hoffe.
In grenzenloser Liebe
Dein H.
So kalt, wussten die Medien zu berichten, war es seit mehr als fünfzig Jahren nicht mehr gewesen. Die lokalen Zeitungen holten die Fotos von der Seegfrörni aus dem Archiv, als die Zürcher 1963 auf dem See Schlittschuh liefen. Die kleinen Seen in der Umgebung der Stadt, der Katzensee, der Türlersee, selbst der Greifensee waren bereits zum Betreten freigegeben.
Das Auto stotterte bloß. Drei, vier Versuche unternahm Gabriel Klein, dann gab er es auf. Als er die Pannenhilfe anrief, wurde ihm beschieden, man könne ihm frühestens in drei Stunden Hilfe schicken – Ausnahmezustand. Er solle wenn möglich die öffentlichen Verkehrsmittel benützen. «Wenn Sie können, lassen Sie das Auto einfach stehen, bis es wärmer ist. Das hilft womöglich schon.» Sie mussten tatsächlich ziemlich am Anschlag sein, wenn sie solche Tipps gaben.
Seit langem hatte Rivka moniert, sie bräuchten einen Garagenplatz, doch Klein hatte sich dem immer widersetzt. «Bei den Mieten in unserer Gegend zahlen wir in einem Jahr mehr, als das ganze Auto wert ist», hatte er ihr gesagt. Mochte sein – jedenfalls musste er jetzt nach Bern den Zug nehmen.
Er hatte aus Bern auch gleich seine Schwiegereltern, die dort wohnten, nach Zürich nehmen wollen. Zum Glück hatte Rivka das gestern schon getan, als das Auto noch funktionierte. Er hatte das zuerst übertrieben gefunden – wenn er heute doch hinfuhr, hatte er gemeint, dann könne er sie mitnehmen. Der Flug nach London ging ja erst morgen früh. Doch Rivka kannte die Ängste und die Unbeweglichkeit ihrer Eltern. Wenn sie morgen früh schon um fünf Uhr aufstehen mussten, um den Flieger zu bekommen, dann sollten sie wenigstens heute in Zürich einen geruhsamen Tag zur Vorbereitung haben.
Rivka hatte sich auf die Reise gefreut. Sie hatte ihren Bruder in London länger nicht besucht, und da ihre Eltern die Reise zur Barmizwa ihres Enkels davon abhängig machten, dass sie mitkommen würde, war ihr der Entschluss nicht schwergefallen. Doch je näher die Reise rückte, desto nervöser wurde sie – eine Mischung aus Angst, vor allem um ihren gebrechlichen Vater, aus Bedauern, Klein und die Töchter in Zürich zurückzulassen, und aus Vorfreude und Unbehagen vor einem Schabbat in der ziemlich mondänen Gemeinde in Hampstead. Sie hatte sich für die Gelegenheit zwei neue Kleider und ein ganzes neues Set Make-up gegönnt. Und natürlich würde sie den eleganten wattierten Kapuzenmantel tragen, den Klein ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, ihr «Hautevoleestück», wie sie es nannte.
Missgelaunt stieg Klein aus dem eiskalten Auto und warf die Tür zu. Er hatte ohnehin keine Lust, nach Bern zu fahren, und tat es nur, weil er die letzten beiden Sitzungen der interreligiösen Kommission geschwänzt hatte, und ein drittes Mal käme ihm ungehörig vor. Zudem war heute die kleine jüdische Gemeinde von Bern der Gastgeber, da wäre es ein besonderer Affront, wenn gerade er fehlte.
Als Klein in der Bahn saß, fand er schließlich, dass das eigentlich bequemer sei als im Auto. Er kaufte sich, als die Minibar durch den Gang rollte, einen Kaffee und nahm die prall gefüllte Klarsichtmappe aus der Tasche, die er zur Lektüre eingesteckt hatte – als hätte er eine Vorahnung gehabt, dass es am Ende mit dem Auto nichts würde. Es war ein Konvolut mit Kopien von sorgfältig handgeschriebenen Briefen. Fast drei Monate hatten sie in seinem Arbeitszimmer gelegen, bevor er beschlossen hatte, sie genauer anzusehen.
Warum er sich so lange davor gedrückt hatte, wusste er selbst nicht genau. Als Historiker war er eigentlich an Selbstzeugnissen interessiert, und was ihm Julia Scheurer über die Briefe ihres Vaters erzählt hatte, klang eigentümlich genug. Wahrscheinlich war sein Desinteresse eher psychologischer Natur gewesen.
Offenbar, so hatte Klein aus Julias Erklärung verstanden, hatte Röbi Fuchs den «Herrn Rabbiner Klein» seinem Rotarierfreund Christoph Scheurer, Julias Mann, empfohlen. Christoph Scheurer saß, wie Klein herausfand, in der Geschäftsleitung des Unterland-Versicherungskonzerns. Nicht zum ersten Mal hatte Klein das Gefühl gehabt, als eine Art Hausintellektueller der gutbetuchten Zürcher Juden auch an ihre nichtjüdischen Bekannten weitergereicht zu werden.
Natürlich wusste Röbi Fuchs, dass Klein niemanden abweisen konnte, der sich auf ihn berief. Röbi Fuchs war der Gemeindepräsident gewesen, der seinerzeit, vor über zwanzig Jahren, Klein als Rabbinatsassistenten eingestellt und ihn vom Elend seiner Universitätsstelle befreit hatte. Röbi Fuchs hatte auch für das Geld und die Zustimmung im Vorstand gesorgt, um ihn später zur Vollendung seiner Rabbinatsausbildung zwei Jahre lang nach Israel zu schicken. Wenn Klein heute der Rabbiner der größten jüdischen Gemeinde der Schweiz war, verdankte er das zu einem guten Teil Röbi, und so patriarchalisch dieser zuweilen auch auftrat, spürte Klein doch immer auch echte Zuneigung und war ihm emotional verbunden. Aber deshalb musste man nicht gleich bei jedem Rotarierfreund von Röbi Fuchs oder dessen Frau sofort «Männli mache», wie es Kleins verstorbener Vater genannt hätte. Schon die Würde seines Amts verlangte es, fand Klein, dass er Julia Scheurers Unterlagen eine Weile liegenließ. Aber drei Monate? Frau Scheurer hatte sich zwar noch nicht gemeldet und nach Kleins Eindrücken gefragt, doch es war sicher höflicher, darauf nicht erst zu warten.
Die siebzig oder achtzig Briefe hatte sie gefunden, als die Familie nach dem Tod der Mutter das Elternhaus in der Nähe des Brienzersees geräumt hatte. Sie befanden sich in einer unscheinbaren Schuhschachtel auf dem Dachboden, und Julia hatte sofort die Schrift ihres Vaters erkannt, der bis zu seinem Tod in den frühen achtziger Jahren immer mit demselben Füllhalter geschrieben hatte – dem ersten Gegenstand, wie er ihr einmal erzählte, den er sich kaufen konnte, als er gegen Ende des Kriegs mit einem Transport aus Theresienstadt in die Schweiz gekommen war.
Hermann Pollack hatte seinen Kindern hin und wieder von seiner ersten, jüdischen Frau Elisabeth erzählt. Julia und ihre Schwestern wussten, dass er sie als junger Arzt im Wiener Rothschild-Spital kennengelernt hatte, als sie dort wegen eines Beinbruchs zwei Wochen verbrachte. Dass sie 1938, kurz nach der Annexion Österreichs, geheiratet hatten, es aber angesichts der immer schwierigeren Situation vermieden, Kinder in die Welt zu setzen. Dank seiner Tätigkeit als Arzt hatte Hermann Pollack noch bis 1943 im Krankenhaus praktizieren können, dann wurden er und Elisabeth gemeinsam nach Theresienstadt deportiert. Er hatte einen Transport nach Auschwitz vermeiden können, weil er als Arzt für die inhaftierten Juden arbeitete. So war es ihm auch gelungen, Elisabeth vor der Deportation zu bewahren, doch Mitte Januar 1945, kurz bevor sie beide mit einem Transport des Roten Kreuzes in die Schweiz hätten ausreisen können, war sie an Tuberkulose gestorben.
Hermann Pollack war bei der Ankunft ebenfalls geschwächt und wurde in das jüdische Krankenheim nach Davos gebracht. Später fand er eine Stelle bei einem Bezirksspital im Berner Oberland, wo er die Orthopädie- und Trauma-Abteilung aufbaute. Er heiratete die viel jüngere Tochter seines ersten Chefs aus dem Emmental und hatte mit...









