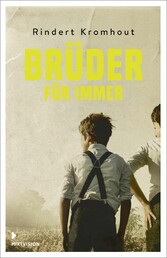
Brüder für immer

von: Rindert Kromhout
Mixtvision, 2017
ISBN: 9783958548879
Sprache: Deutsch
256 Seiten, Download: 2248 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1925
Der Autobus, der uns vom Bahnhof zum Bauernhof brachte, hielt direkt vor einer buckligen und löchrigen Auffahrt. Pappeln säumten die Allee.
Meine Mutter und Duncan hatten beschlossen, aus London fortzuziehen. Sie fanden die Stadt zu voll, die Häuser zu finster, die Ateliers zu klein.
»Ich brauche Licht um mich herum«, hatte meine Mutter gesagt, »und Raum.«
»Ich will unter freiem Himmel malen«, hatte Duncan gesagt.
»Ich will barfuß durchs Gras laufen.«
»Einen Garten, in dem sich die Kinder verirren können.«
Deshalb waren wir jetzt hier. Tante Virginia hatte ein Haus gefunden, das, wie sie meinte, genau das war, was wir suchten.
Mein Vater war auch dabei, um das Haus zu besichtigen, auch wenn er selbst nach wie vor in London leben wollte. Er hatte dort eine eigene Wohnung und seine Arbeit bei der Zeitung, aber er hatte versprochen, uns so oft er konnte zu besuchen.
Seine Freundin, die Julian und ich »Tante Margaret« nannten und von der wir ab und zu Geschenke bekamen, wohnte auch in London. Schon allein wegen dieser Geschenke fanden Julian und ich es schade, dass wir aus der Stadt wegziehen mussten.
Puck, der braune Spaniel, rannte vor uns her. Julian und ich sprangen über Pfützen und taten so, als wären es tiefe Schluchten, in die wir stürzen könnten.
Am Ende der Allee lag ein Bauernhof mit Kühen und Schafen und einem Heuhaufen. Ein Schwein steckte den Rüssel durch ein Gatter. Das Haus, das wir besichtigen wollten, war ganz in der Nähe und gehörte dem Bauern. Es war riesig, hatte gelbe Mauern, an denen Kletter-Hortensien wuchsen, zahllose Fenster und einen ummauerten Garten mit Teich. Weil der Bauer keine Verwendung mehr für das Gebäude hatte, wollte er es vermieten. Die Mieter hatten bei allem freie Hand, solange sie pünktlich die Miete zahlten und es nicht abrissen. »Es steht schon zwei Jahre leer, Mr Grant«, sagte er. »Ein paar Dinge müssen Sie wohl ausbessern. Sehen Sie sich in Ruhe um.«
»Ein paar Dinge ausbessern.« Das war wohl witzig gemeint, denn es gab wirklich nichts an dem Haus, das nicht auszubessern wäre. Der Garten war eine einzige Schlammlache, in dem nur ein paar sterbende Obstbäume standen. Und das Haus war kalt und feucht. Es gab keinen Strom. Wasser musste man auf dem Bauernhof pumpen. Die Toilette war ein Holzverschlag im Garten, mit einem Eimer in einem Erdloch. Das Haus war seit Jahren weder innen noch außen gestrichen worden.
Während die Erwachsenen kopfschüttelnd von Zimmer zu Zimmer gingen, erkundeten Julian und ich zusammen mit Puck den Garten. Im Teich quakten Frösche. Puck bellte und die Frösche tauchten ab.
»Dort werden wir ein Baumhaus bauen«, rief Julian. Er deutete auf die beiden Bäume mit dicken Stämmen und Ästen, die ineinanderwuchsen. Die längsten Äste hingen über die Gartenmauer. »Dann werfen wir dem Schwein Äpfel zu und zähmen es. Und Mama erlaubt uns vielleicht, es zu behalten.«
Julian war neun, drei Jahre älter als ich, und immer voller Ideen. Ich bewunderte ihn bedingungslos. »Und dann bringen wir ihm Kunststücke bei«, sagte ich.
Der Himmel zog sich zu, nasskalter Herbstregen fiel. Wir gingen ins Haus und stritten uns, wer welches Zimmer bekommen sollte, wo das Baby schlafen würde (möglichst weit von uns entfernt) und wo das Schwein leben könnte. Schreiend stürmten wir die Treppe hoch, und noch eine, hinauf zum Dachboden, wo mein Vater vor dem Fenster stand und meine Mutter und Duncan auf wackligen Stühlen saßen. Ich zitterte. Hier war es noch kälter als draußen.
Duncan seufzte. »Ich habe noch nie ein so verwahrlostes Haus gesehen. Noch nie.«
»Die Wände sind voller Schimmel«, sagte meine Mutter. »Und der Wind pfeift durch die Ritzen.«
»Eine ziemlich weite Reise von London hierher«, sagte mein Vater.
Ängstlich sah ich zu ihnen hoch. Wollten sie das Haus etwa nicht? Würden wir etwa nach London zurückgehen? Weg vom Schwein? Ich hatte gerade beschlossen, es Pigling zu nennen, wie das Ferkel in der Geschichte von Beatrix Potter, und dass es mich lieber haben würde als meinen Bruder. Auch Julian hatte einen Schreck gekriegt, das sah ich ihm an.
Dann sagte meine Mutter: »Ich denke, wir werden hier sehr glücklich sein.«
Duncan nickte. »Das denke ich auch, Vanessa. Ja, absolut.«
Mein Vater lächelte.
~
Charleston, so hieß unser Haus, stand in den Hügeln von Sussex im Südwesten Englands. Von London waren es knapp zwei Stunden mit dem Zug nach Lewes, der nächstgelegenen Stadt, und dann waren es noch eineinhalb Stunden mit dem Autobus, der vor unserer Auffahrt hielt.
In den ersten Tagen waren meine Mutter und Duncan damit beschäftigt, unsere Sachen auszupacken und die Zimmer einzurichten. Julian und ich beschlossen, die Umgebung zu erkunden.
Bevor wir losliefen, fütterten wir das Schwein mit altem Brot aus der Küche und mit faulen Äpfeln, die wir im Garten gefunden hatten. Zufrieden schmatzend blickte es uns nach, als wir uns auf den Weg machten.
Hinter dem Bauernhof und der Weide mit den Schafen befanden sich ein paar kleine Häuser.
»Komm, wir schauen, ob dort Kinder wohnen«, sagte Julian. Er kroch unter dem Stacheldraht durch und lief auf die Weide.
Ich zögerte. Die Schafe waren groß und sahen mich böse an. Nie zuvor war ich Schafen so nahe gekommen. Ehrlich gesagt: Ich hatte noch nie ein echtes Schaf gesehen, nur gezeichnete in einem Kinderbuch.
»Sie beißen«, sagte ich.
»Aber nein«, sagte Julian. »Sie sind genauso lieb wie das Schwein. Na, komm schon.«
Ich wollte nach London zurück, wo es keine lebensgefährlichen Tiere gab. »Ich traue mich nicht.«
Jeder andere Bruder hätte einen Angsthasen wie mich in diesem Moment ausgelacht oder später zu Hause erzählt, was für ein Feigling ich doch wäre, aber nicht Julian. Er sah mich ernst an, kroch wieder unter dem Stacheldraht durch und nahm mich an die Hand.
»Wir gehen um die Weide herum.«
Erleichtert hüpfte ich mit ihm mit.
Es war Herbst. An den Rändern der Wassergräben saßen kleine Frösche, an den Bäumen verfärbte sich das Laub. Ein langes, braunes Tier schoss an uns vorbei und verschwand im Gebüsch. Ich war in einer neuen Welt angekommen.
Vor einem der kleinen Häuser hinter der Weide hängte eine Frau im Garten frisch gewaschene Laken auf. Wir liefen zu ihr hinüber. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und sah uns freundlich an. »Wenn ich mich nicht irre, sind Sie Master Julian Bell«, sagte sie, »und Sie müssen Master Quentin sein.«
Wir mussten lachen. Die Frau nannte uns ›Master‹! Wir wussten damals noch nicht, dass dies Grace Higgins war, die bei uns als Köchin und Haushälterin arbeiten würde.
Es war übrigens das einzige Mal, dass Grace ›Master‹ zu uns sagte. Sie hat es nie wieder getan, weil meine Mutter es ihr verboten hat. »Ihr seid keine Master, ihr seid Lausejungs«, sagte sie zu uns, »und das ist etwas ganz anderes.«
Ich nickte. Lausejungs klang viel besser als Master.
»Wohnen hier Kinder?«, fragte Julian.
Grace schüttelte den Kopf. »Aber im Nachbardorf. Das ist zu weit für euch, um hinzulaufen.«
»Gut«, sagte Julian, »dann suchen wir eben Holz für unser Baumhaus.«
Wenn ich an Grace denke und an unsere ersten Monate in dem damals noch kalten und unbehaglichen Charleston, dann erinnere ich mich am liebsten an die Samstage, an denen wir nachmittags ins Bad gesteckt wurden.
Grace setzte auf dem Kohlenherd in der Küche Wasser auf und schüttete es dann in eine Zinkwanne, die dafür im Esszimmer vor den Kamin aufgestellt wurde. Weil Julian der ältere war, durfte er zuerst in die Wanne. Wenn ich an der Reihe war, goss Grace ein paar Kessel nach, damit das Wasser schön heiß blieb. Genussvoll erschauerte ich, wenn sich das heiße Wasser mit dem kälteren vermischte. Angelica war erst ein Jahr alt und noch zu klein für die Wanne. Sie wurde in der Küche gewaschen.
Nach dem Bad saßen wir in Handtücher gewickelt vor dem Kaminfeuer und Mutter las uns Märchen vor. Später, als wir älter waren, wurden Alice im Wunderland und Der Wind in den Weiden unsere Lieblingsbücher. Sie erzählte uns auch Bibelgeschichten. Nicht, weil wir an Gott glauben sollten, sondern weil wir diese Geschichten noch in zahllosen Büchern und auf Gemälden antreffen würden. Wer die Bibel kannte, könne andere Bücher und Gemälde besser verstehen, meinte sie. Ich mochte vor allem Alice im Wunderland, denn durch dieses Buch entdeckte ich, wie großartig es war, mit Worten zu spielen. Ein Wort an der falschen Stelle konnte ein Missverständnis auslösen und sofort stand die ganze Welt Kopf. Dass Worte so etwas bewirken konnten! Dieses Buch war der Grund dafür, dass ich ein paar Jahre später beschloss, Schriftsteller zu werden. Nicht Tante Virginia. Nicht Lytton, sondern Alice im Wunderland.
Ob Grace uns anfangs seltsam gefunden hatte? Wenn es so war, dann hat sie es uns zumindest nicht spüren lassen. Ihr Nachbar hingegen fand uns ziemlich seltsam. Er war Postbote und wohnte in einem kleinen Haus mit einem Garten voller Brombeersträucher. Der Garten ähnelte einem Kopf mit strubbeligen Haaren, die lange nicht mehr gekämmt worden waren. Wir mussten den Postboten Colonel Kipling nennen, denn er hatte im Weltkrieg gekämpft. Wenn man in der Armee gewesen ist, war man kein ›Mister‹ mehr, sondern Colonel oder Major oder Captain. Eines Morgens, als Colonel Kipling die Post brachte, deutete er auf Duncan, der gerade mit einem Strohhut auf dem Kopf im Garten...









