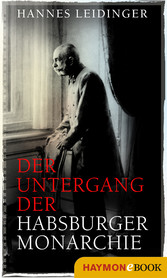
Der Untergang der Habsburgermonarchie

von: Hannes Leidinger
Haymon, 2017
ISBN: 9783709938065
Sprache: Deutsch
440 Seiten, Download: 19464 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Teil II: Pfade durch das Dickicht der Widersprüche und Mehrdimensionalität – Schlüsselfragen und „Architektur“ des Buches
Aktuelle Deutungen
„Konnte es wenigstens für ein föderalistisches Österreich eine Zukunft geben“, nachdem es bei Königgrätz von Preußen besiegt und aus „Deutschland hinausgedrängt“ worden war? Konrad Canis’ aktuelle Veröffentlichung zur „bedrängten Großmacht“ Österreich-Ungarn im „europäischen Mächtesystem“ stellt diese Schlüsselfrage und widmet sich dabei der Zeit bis 1914. In einer äußerst differenzierten Darstellung, die internationale Beziehungen immer wieder mit innenpolitischen Entwicklungen abgleicht, gelangt Canis zu einem insgesamt eher negativen Ergebnis: Für ein Weiterbestehen „gab es kaum Aussichten. So zeichnete sich bereits 1866 das Dilemma ab. Allein halbe und instabile Kompromisse schienen möglich. Deshalb ist die Auffassung ziemlich verbreitet, daß dem danach neukonstruierten System die Gefahr des Verfalls von Anfang an eigen war“.1
Obwohl sich die Habsburger aus der „revolutionären Krise“ von 1848 „herauswinden konnten“, war ihnen auf dem diplomatischen Parkett der „Stempel der Reaktion und des Stillstandes aufgedrückt“, mangelte es ihrem Reich „an wirtschaftlichem, politischem, militärischem und finanziellem Potential“, so der Befund. Und weiter: „Alle Faktoren zusammengenommen lassen erkennen, wie begrenzt die Zukunftsaussichten des Systems“ waren. „Nach Königgrätz schien lediglich Zeit gewonnen“, um „vorläufig eine gewisse innere Sicherheit und Voraussetzungen für eine Großmachtpolitik zu gewinnen, deren Grenzen sich jedoch rasch zeigen sollten. Eine Gewähr, gar eine sichere Entscheidung für die Zukunft bedeutete“ das aber nicht.2
Trotzdem gilt die Einschränkung: „Das Urteil, den Anfang a priori auf ein absehbares unvermeidliches Ende der Doppelmonarchie zulaufen zu sehen“, geht „zu weit, wenngleich durch den Verlauf bis zum Ende dieser Weg vorgezeichnet scheint“.3
Wie aber mit dieser Einschätzung umgehen? Gewiss stimmt es, dass Ideen, Pläne und Konzepte existierten, „die nicht alle von vornherein zum Scheitern verurteilt sein mußten“. Und ebenso zutreffend ist es, dass auch in der Vergangenheit die „Perspektiven für die Zukunft“ erst „einmal offen“ waren. Krisen „konnten sich verstetigen oder sogar verschärfen. Doch sie konnten sich auch abschwächen. Es konnten neue Entwicklungen eintreten, die Chancen boten, nach innen wie nach außen“.4
Diesen Ansatz greift ein fast zeitgleich erschienenes Buch von Pieter M. Judson auf, das sich im englischen Original als „neue Geschichte“ des habsburgischen Imperiums versteht und dessen Überlebensfähigkeit betont: „Die Beamten und Parteipolitiker“ des Reiches „hatten schon seit langem Flexibilität und Kreativität an den Tag gelegt, wenn es darum ging, strukturelle Änderungen auszuhandeln, die zu einem besseren Funktionieren“ des Gemeinwesens „beitragen und ihm langfristige Stabilität verleihen sollten“.5 Auch als Hort der Abwehr gegen Modernisierungserscheinungen lasse sich die Donaumonarchie nicht begreifen, heißt es hier des Weiteren. Denn: Unter anderem die Wahlen bestätigten, „dass die Hoffnungen der Regierung, und sogar des Kaisers, die Reform könnte überregionale Parteien an die Macht bringen, die darauf aus waren, das Reich gegen die regionalen Kräfte des Nationalismus zu stärken, berechtigt gewesen waren“.6 Also ein System „mit Zukunft“, dem im Übrigen auch auf der Mikroebene keineswegs der Todesbazillus eingepflanzt war? Schließlich zeigten Untersuchungen, dass sich „Gegensätze“ größtenteils „in Luft auflösten, wenn man Ergebnisse aus der Untersuchung lokaler Gesellschaften zur Überprüfung heranzieht“.7
Die jüngsten Publikationen widersprechen einander keineswegs diametral, verfügen allerdings nur über beschränkte Schnittmengen. Gegenläufige Argumentationstendenzen scheinen, wie von den Autoren hervorgehoben, vom Fokus abzuhängen, etwa vom Blick auf die inneren Entwicklungen einerseits oder auf grenzüberschreitende Phänomene und Spannungsfelder andererseits.
Erstaunliche Einsichten
Im einen wie im anderen Fall aber überraschen die Ereignisse von 1914 und bis zu einem gewissen Grad sogar die Geschehnisse in den nachfolgenden Jahren: Das System hielt, anders als oft vorhergesagt, dem „Großen Kräftemessen“ zunächst stand: Die Soldaten aller Völker schlugen sich im Ersten Weltkrieg für „ihren Kaiser“ mit bemerkenswertem Gehorsam. Uniformierte wie Zivilisten begehrten nicht gegen den Waffengang auf und lieferten – wenn auch in unterschiedlicher Intensität – Beispiele für „loyales Verhalten“.
Und nicht nur das. Auch aus anderen Blickwinkeln betrachtet konnten die imperialen Eliten noch zur Jahreswende 1916/17 zufrieden sein: Serbien besiegt und besetzt. Rumänien ebenso. Russland zurückgedrängt und im Inneren geschwächt. Italien erfolgreich abgewehrt. Neue Gebiete hinzugewonnen und zukünftig möglicherweise unter dem Einfluss der habsburgischen Dynastie. Mit Karl ein junger Kaiser an der Macht, voll guten Willens und trotz geringer Erfahrungen auf dem Weg, den Völkern der Monarchie die Hand zu reichen. Selbst unter den radikalen Nationalitätenvertretern noch keine eindeutige Abwendung vom gemeinsamen Staat. Ergo: Der Erste Weltkrieg vereinfachte die Lage Österreich-Ungarns zwar keineswegs. Aber die Anzeichen eines völligen Zusammenbruchs hielten sich trotz sozialer Spannungen und wirtschaftlicher Krisen in Grenzen.
Die Umwälzungen der folgenden Jahre waren keine ausgemachte Sache, auch nicht für die „Feindesländer“ – erst recht nicht vor 1914. Zwar sprach die in- und ausländische Presse 1913 von einem skandalgeschüttelten Reich, das keine Idee, sondern lediglich eine Verwaltung besitze und „schwer erkrankt“ das Bett hüten müsse.8 Aber handelte es sich deswegen schon um ernstzunehmende Andeutungen eines nahenden Ablebens?
Die Symbolfigur der „Altersschwäche“ und des Anachronismus, Franz Joseph I., wurde jedenfalls selbst von jenen Kräften, die den „großbürgerlichen-aristokratischen Eliten“ nicht allzu nahestanden, differenzierter gesehen. Bei seinem Regentschaftsjubiläum 1908 war in Bezug auf den k. u. k. Staat außerdem von der „Einschränkung“ weiterer „räumlicher“ Entfaltung die Rede, gleichzeitig aber auch von „unbegrenzten inneren Entwicklungsmöglichkeiten“.
Das Schicksalhafte und der offene Horizont: Fragen an die Vergangenheit
Im Widerspruch dazu standen freilich fortgesetzte ethnische Konflikte und Warnungen vor dem Reichszerfall, gefolgt von der Tatsache, dass der Kollaps im November 1918 Wirklichkeit wurde, es dafür also „gute Gründe“ geben musste. Für manche Beobachter und Kommentatoren präsentierten sich die Geschehnisse jedenfalls als Verkettung unvermeidlicher Umwälzungen. Schicksalhaft trat vor ihr Auge eine „Logik des Zusammenbruchs“.
Die vermeintliche Vorherbestimmtheit des Nieder- und Untergangs in der Retrospektive forderte freilich angesichts der irritierenden Gegenbilder zu Widerspruch heraus, wie auch einige eingangs zitierten Wortmeldungen belegen, die letztlich immer wieder um die Frage kreisen: Hätte es also doch anders kommen können?
Eine vielfach zum Spekulativen verführende Geschichtsdeutung ist allerdings gar nicht nötig. Dem Kontrafaktischen als reizvolles Gedankenspiel treten nachweisbare Alternativen in den Quellen gegenüber. Und mit ihnen drängen sich noch einmal Schlüsselfragen auf: War das Ende 1918 unausweichlich, vielleicht verspätet, vielleicht vorzeitig? Oder existierte die Donaumonarchie in gewisser Weise ohnehin weiter? Nicht bloß als „Erbe des Doppeladlers“, nicht nur – wie so oft belegt – kulturell und mental?9
Bei genauerer Betrachtung löst sich der „November achtzehn“ als scharfer Trennstrich zwischen den Epochen auf. Raumkonzepte, Handelsnetze, Wirtschaftskontakte, Entscheidungsmechanismen, Rechts- und Elitenkontinuitäten geraten in den Blickpunkt. Darüber hinaus wirkt die Zäsur gewissermaßen wie die Umwandlung der einen „Monarchie“ in viele „Imperien“.
Aber bestanden zwischen diesen nur Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten oder vielmehr tiefer gehende Verflechtungen? Gab es einen „Commonwealth“ des Donauraumes, und wenn ja, wie lange? Waren seine multikulturellen, grenz- und milieuüberschreitenden Signaturen geradezu idealtypisch etwa in die jüdischen Lebenswelten eingeschrieben?
Und fern von jeder Nostalgie: Bildeten der Donauraum, „Österreich“ und das „Haus Habsburg“, wie so oft dargestellt, eine untrennbare Einheit, oder gab es Hinweise auf lang zurückreichende Reibungsflächen und Entflechtungen zwischen dem, was angeblich unzertrennlich war?
Die Gliederung des Buches
Das Buch folgt gegenläufigen Erzählungen und Interpretationen, die vielfach von gewohnten Sichtweisen wegführen. Es misst den zweifelsohne erkennbaren Epochenbruch von 1917/18 daher neu ein, zergliedert sich doch die Historie in unterschiedliche geographische, zeitliche, materielle und geistige Räume, Tempi, Kontinuitäten, Beschleunigungen und Zäsuren, Beständigeres und Kurzfristiges oder „Ereignishaftes“. Miteinander verflochten, verursachen sie Zuspitzungen und Entspannungen, schaffen und überwinden sie Widersprüche oder Paradoxien, bringen sie „Wellenbewegungen“ und Zyklen ebenso hervor wie tiefer liegende, lineare, scheinbar zielgerichtete Tendenzen.
Derlei abstrakte Phänomene fordern zur konkreten Überprüfung auf, die nur mit Hilfe von...









