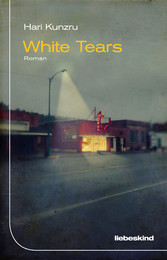
White Tears - Roman

von: Hari Kunzru
Verlagsbuchhandlung Liebeskind, 2017
ISBN: 9783954380824
Sprache: Deutsch
356 Seiten, Download: 397 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
NORMALERWEISE HÄTTEN LEUTE WIE WIR eine Band gegründet, aber Carter interessierte sich mehr für die Arbeit im Studio. Er war kein Poser. Wer das behauptete, kannte ihn nicht. In den Wochen nachdem wir uns auf dem College kennengelernt hatten, erklärte ich ihm mein Equipment, und wir bastelten zusammen an ein paar Breakbeats. Er fand das super und fing an, sich eigenes Zeug zu kaufen – Dinge, ohne die ich bisher hatte auskommen müssen, zum Beispiel gute Boxen und eine Pro-Tools-Version, die nicht von der unbeschrifteten CD eines Chinesen vor einem Supermarkt stammte. Dann sprach er ein paar Musikstudenten an und überredete sie allein mit seinem Charisma, unbezahlt einzuspielen, was wir uns ausdachten. Sie taten, was wir ihnen sagten, und wir spielten damit herum und ließen sie, je nachdem, wie Africa ’70 oder The JB’s klingen.
Ich kann gar nicht sagen, was für eine krasse Veränderung das für mich war. Bis dahin war ich es gewohnt, allein zu sein. Plötzlich war ich umgeben von Menschen, im Zentrum nächtelanger chaotischer Aufnahmesessions, die manchmal in Partys ausarteten, wenn Freundinnen und Möchtegernfreundinnen und andere Mitläufer, angelockt vom Sexuallockstoff der Musik, auftauchten. Bald schon machte sich Carters begrenzte Toleranz gegenüber Computern bemerkbar. Er hasste es, auf Mäuse zu klicken und auf Bildschirmen rumzutippen. Also durchkämmte er Auktionsseiten nach altem Equipment, alles, was Regler hatte, die er schieben, und Knöpfe und Einstellringe, an denen er drehen konnte. Er kaufte für viel Geld einen Bass-Synthesizer und einen Drumcomputer aus den Achtzigern, legendäre Geräte, die die meisten nur als Software kannten. Eine Zeit lang vertieften wir uns in Electro und matschige Acid Sounds und hielten uns für die Könige der Block Party, die Superstars des Raves.
Bis dahin hatte ich mir keine großen Gedanken über den Unterschied zwischen den digitalen Klängen, mit denen ich aufgewachsen war, und ihren analogen Vorfahren gemacht, Klänge, die durch die Veränderung der elektrischen Ladung in einem echten Stromkreis entstanden. Strom ist nicht digital. Man bekommt ihn nicht in kleinen Datenpaketchen. Strom fließt durch die Luft, durch Leiter und schießt aus den Händen verrückter Wissenschaftler in Stummfilmen. Falls Strom in irgendeiner Hinsicht futuristisch ist, dann als alte Version der Zukunft, launisch, unbeständig, quasi lebendig. Wenn man mit alten Synthesizern herumspielt und Klänge produziert, indem man in Oszillatoren Schwingungen erzeugt, entspricht das eher einem Chemieexperiment als der überdrehten Zwanghaftigkeit in einem digitalen Studio. Carter und ich entwickelten uns zu Kennern analoger Halleffekte. Die Dateien-Archive im Internet interessierten uns nicht, stattdessen fand ich ein paar Schaltpläne, nach denen wir einen primitiven Federhall bauten, der fantastisch vibrierte und schepperte, wovon wir bei jeder Aufnahme übermäßigen Gebrauch machten. Wir wollten wie Lee Perrys Black Ark Studio in Jamaika klingen. Perry war damals unser Idol, unser Gott. Der Mann probierte einfach alles aus. Um einen bestimmten Rhythmus zu erzeugen, vergrub er Mikrofone unter Palmen und trommelte dann auf der Erde herum. Wir probierten dasselbe mit einer Pinie (wir lebten ja im Nordosten), mit mittelmäßigem Ergebnis. Einmal schüttete er eine Sandschicht auf den Studioboden, baute einen hohlen Drumriser aus Holz und Glas und füllte ihn mit Wasser. Das sollte den Klang des Schlagzeugs beeinflussen. Wir bauten etwas Ähnliches und setzten prompt das neu eingerichtete College-Studio unter Wasser.
Wir bewunderten die Musik von Leuten wie Perry, aber uns war klar, dass es nicht unsere war. Das ignorierten wir allerdings so gut es ging, indem wir unsere hautfarbenbedingte Unzulänglichkeit hinter einer Art professoralem Wissen versteckten: Wer spielte Congas auf der B-Seite, was genau war collie. Die wenigen Schwarzen an unserer Schule waren uns zu adrett oder zu christlich oder waren Basketballcracks, die Wirtschaft studierten, Mädchen aus Studentenverbindungen entjungferten und in der Mensa laut über ihre Lieblingsmarken schwafelten. Es kam uns ungerecht vor. Wir waren es, die zum Soundclash nach Kingston wollten. Wir wussten, wonach John Coltrane suchte, als er im Mittelteil von A Love Supreme sein Tenorsaxofon überblies. Es gab einen Nigerianer namens Ade, den wir mochten, weil er mit seinen kurzen Dreads ein bisschen wie der jamaikanische Sänger Hugh Mundell aussah, der mit einundzwanzig Jahren erschossen wurde. Ade rauchte viel von Carters Gras, während er über die Brutalität der Polizei debattierte, aber das änderte nichts daran, dass er Wildlederloafer und eine Patek Philippe trug. Sein Vater war in Lagos im Ölgeschäft tätig.
Es dauerte nicht lange, bis wir voller Scham auf unsere Rastaphase zurückblickten. Carter hatte für kurze Zeit eine rot-gold-grüne Mütze getragen und fürchtete jetzt, dass Bilder von ihm mit der Mütze auf Facebook auftauchten. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Liebe zur Musik uns das Recht verlieh, schwarz zu sein, aber als wir dann später nach New York gingen, redeten wir nicht mehr darüber. Wir wollten nicht, dass man uns für weiße Vorstadtkids hielt, die Bilder mit Starkbier-Flaschen und Gangposen von sich posteten.
In unserem letzten Jahr zogen Carter und ich in eine Wohnung außerhalb des Colleges. Für mich zeichnete sich eine ungewisse, beängstigende Zukunft ab. Ich brachte kaum meine Miete auf, obwohl ich einen Job in der College-Verwaltung hatte und außerdem bei einem Deli Wraps und Sandwiches belegte. Ich hatte genug Schulden, um von Eisbergen und schwankenden Bücherregalen zu träumen. Wenn Carter »den Abflug« machte, dann ich auch, und zwar zurück zu meinem Vater nach New Jersey. Ich war nicht sicher, ob ich es ertragen würde, in meinem alten Kinderzimmer zu liegen und auf die Toten im Flur zu lauschen. Für den Ernstfall hatte ich Schlaftabletten gehortet.
Also bemühte ich mich um ein Praktikum bei einem Aufnahmestudio in New York oder Los Angeles. Ich hätte alles genommen – Kaffee kochen, Kabel schleppen –, was mich einer bezahlten Stelle näher brachte, bevor einer meiner diversen Kreditkartenanbieter mich vor Gericht zerrte. Ich hatte mir eine Deadline gesetzt. Wenn ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Job im Musikbusiness gefunden hatte, würde ich das Angebot meines Cousins annehmen, der mir ein Vorstellungsgespräch bei seinem Maschinenbauunternehmen in Boston organisieren wollte. Falls das auch nicht klappte, konnte ich immer noch irgendwas mit Technical Support oder in der Gastronomie machen.
Carter dagegen musste sich natürlich keine Sorgen machen. Er spielte mit dem Gedanken, mit seiner aktuellen Freundin, einem Model namens Mariam oder Miriam, auf Reisen zu gehen. Sie war Afrikanerin und hatte einen französischen Akzent, ihr Vater war der Konsul von Senegal in San Francisco, glaube ich. Carter wollte mit ihr auf einer Jacht durch die Karibik segeln. Ich wollte Zeit mit ihm verbringen, den letzten Tropfen aus unserer Freundschaft wringen, bevor sich unsere Wege trennten. Denn genau so würde es laufen: Für ihn begann der Rest eines traumhaften Lebens, während ich bestenfalls in irgendeinem Gewerbegebiet vor dem Kopierer hockte und schlimmstenfalls in der Klapse mit nacktem Arsch im Krankenhemd vor mich hin vegetierte. Den Tränen nahe verbrachte ich Stunden in meinem Zimmer und stellte mir Carter auf Poolpartys vor und wie er auf Dachterrassen Cocktails trank. Ich trauerte ihm nach, als wäre er schon weg.
Carter hatte bald die Nase voll von meiner Lethargie. Er wurde immer sarkastischer und dachte sich abfällige Spitznamen für mich aus. Ich war der Roboterprofessor, der Tin Man. Mir fehle es an Spontanität und an Herz. Inzwischen hörte er weder unsere alten House- und Techno-Sachen noch andere aktuelle Musik, jedenfalls nichts mit digitalen Sounds. Er hatte eine Hip-Hop-Phase gehabt und sich übers Internet 12-inches von Detroiter Produzenten aus den Achtzigern und Neunzigern besorgt. Jetzt interessierte er sich nur noch für Ethno-Musik und kratzige Doo-Wop-Singles. The Flamingos, The Clovers, The Stereo Sound Of The !Kung Bushmen. Kaum irgendwas hatte mehr Bestand in seinen Augen, alles war verschmutzt von den digitalen Sünden der Moderne. »Nix als Nullen und Einsen«, spottete er und erklärte damit einen Großteil der jüngsten Kultur für nichtig. »Ohne jede Verbindung zum menschlichen Körper.« Hätte ich nicht seine teuren Drumcomputer und Keyboards benutzt, wären sie verstaubt.
Eines Abends saßen wir noch spät in der Küche. Während ich einen Joint rauchte, um den Gestank von Schinken und Mayonnaise aus dem Deli loszuwerden, zupfte er verträumt auf seinem neuen Spielzeug herum, das morgens per Kurier gekommen war, eine Gibson-Mandoline aus den Zwanzigern. Er habe iTunes gelöscht, erklärte er feierlich und hielt die Mandoline so, dass das Licht auf die Sunburst-Lackierung fiel.
»Kann ich verstehen. Die Samplingrate …«
»Scheiß auf die Samplingrate. Die ist mir total egal, könnte von mir aus eine Million Hertz sein. Von wegen verlustfrei. So ein Schwachsinn. Es geht immer was verloren,...









