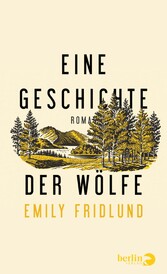
Eine Geschichte der Wölfe - Roman

von: Emily Fridlund
Berlin Verlag, 2018
ISBN: 9783827079701
Sprache: Deutsch
384 Seiten, Download: 1062 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
2
Papierstapel, die herumgegeben wurden. Das war die Highschool. Sie liefen einen Gang hinunter, von Tisch zu Tisch, und kamen dann nach einer langsamen Schleife am Ende des Klassenzimmers einen anderen Gang wieder herauf. Die begabten und talentierten Kinder – die inzwischen zum Lateinklub und zur Forensikgruppe geworden waren – leckten ihre Finger an, um sich ihren Teil vom Stapel zu nehmen. Sie machten sich immer so an die Arbeit, wie die Schwimmer aus dem Schwimmkurs ihre Bahnen zogen, atmeten durch die Mundwinkel, nagten an ihren Bleistiften. Die Hockeyspieler mussten angestupst werden, damit sie aufwachten, wenn der Stapel in ihrer Reihe ankam, mussten mit tiefer Ehrfurcht behandelt werden – sonst würden wir die Bezirksmeisterschaft verlieren. Wieder einmal. Sie erwachten gerade lange genug aus ihrem Schlummer, um sich ein Blatt zu nehmen und den Rest weiterzureichen, lange genug, um offene Chipstüten in ihre Münder zu leeren, sich das Salz von den Lippen zu wischen und zu ihren Träumen von Ruhm und Ehre zurückzukehren. Wovon sollten Hockeyspieler sonst träumen? Wir lebten in ihrer Welt. Das wurde mir mit fünfzehn klar. Sie waren es, die sie ins Dasein träumten. Sie brachten die Lehrer dazu, ihnen ihre leeren Arbeitsblätter zu verzeihen, sie brachten die Cheerleader dazu, vor den Spielen ihre Namen zu schreien, sie brachten die Eisbearbeitungsmaschinen dazu, die Welt, so weit das Auge reichte, mit perfekten, ununterbrochenen Streifen aus gefrierendem Wasser zu überziehen. Wir waren dieses Jahr in einem neuen Gebäude, in einem größeren Klassenzimmer mit blassen Backsteinwänden, aber draußen war alles, wie es seit unserer Kindheit immer gewesen war. Der Winter kam zurück wie ein Bumerang.
Draußen: 1,20 Meter tiefer Schnee, mit einer schimmernden Kruste versiegelt.
Drinnen: Europäische Geschichte, amerikanische Gemeinschaftskunde, Trigonometrie, Englisch.
Biologie kam immer zuletzt dran. Sie wurde von Liz Lundgren, unserer alten Sportlehrerin aus der achten Klasse, unterrichtet, die zum Ende des Schultags in ihrem Polartec-Parka und ihrer Schneehose im Tarnfleckmuster von der Middle School herübergestapft kam. Ms Lundgren hatte einen Tick. Wenn sie sich über etwas aufregte oder für etwas begeisterte, fing sie augenblicklich an zu flüstern. Sie glaubte, dann würden wir besser zuhören; sie glaubte, wir würden uns für Protisten und Pilze interessieren; sie glaubte, wir würden uns mehr anstrengen, Meiose zu verstehen, wenn wir nicht jedes Wort mitbekamen. »Ohne ausreichend Wasser und Wärme … die Sporen … in großen Mengen bewegen«, murmelte sie, und es war, als würde sie irgendein obskures Gerücht weitergeben, das schon so oft erzählt worden war, dass es für uns jede Bedeutung verloren hatte.
In diesem Unterrichtsfach konnte man immer die Uhr ticken hören. Durch jedes der Fenster sah man, wie der Schnee in Böen davongeweht wurde und am nächsten Tag in Form von haushohen Haufen zurückkehrte. Als wir mit der Evolution beinahe durch waren, ließ ein später Schneesturm einen langen Pappelast mit einem eisigen Wumpff abstürzen. Durchs Fenster sah ich, wie er zu Boden fiel und ein kleines blaues Auto, das soeben von dem Lebensmittelladen gegenüber der Schule wegfuhr, knapp verfehlte. Ms Lundgren schrieb gerade in quietschender Schreibschrift die Vor- und Nachteile der natürlichen Auslese an die Tafel. Das Fenster beschlug, als ich mich zu ihm vorbeugte. Ich lehnte mich zurück. Jemand in einem riesigen Kapuzenparka stieg aus dem blauen Auto, zerrte den Ast von der Straße, stieg wieder ein. Dann fuhr der Honda in einem großen Bogen um ihn herum und zermalmte dabei ein paar kleinere Zweige unter seinen Reifen.
Einige Minuten später kam die Sonne heraus: Sie schien so hell, dass wir alle überwältigt waren. Trotzdem waren wir nicht überrascht, als der Schultag wegen der eisigen Winde eine halbe Stunde früher endete. Ich legte den Weg von der Bushaltestelle nach Hause in einem steifen Trab zurück. Ich knirschte über den zugeschneiten Pfad, spürte den Wind, der in heftigen Stößen vom See herüberwehte, hörte die Kiefern über mir ächzen und knarren. Auf der Hälfte des Hügels fühlte sich meine Lunge zerschlissen an. Mein Gesicht wurde zu etwas anderem als einem Gesicht, wurde weggerubbelt. Als ich endlich oben angekommen war, als ich langsamer ging, um mir Eis von der Nase zu wischen, drehte ich mich um und sah eine Auspuffwolke auf der anderen Seite unseres Sees. Ich musste die Augen zusammenkneifen, um sie in dem ganzen Weiß zu sehen.
Es war der blaue Honda-Kleinwagen aus der Stadt. Ein Mann und eine Frau luden das Auto aus.
An dieser Stelle war der See extrem schmal, nicht viel mehr als 250 Meter von einem Ufer zum anderen. Ich sah ihnen ein paar Minuten lang zu, hätschelte meine Finger, knüllte sie zu festen Bällen zusammen.
Ich hatte das Paar schon einmal gesehen, im August. Sie waren vorbeigekommen, um den Bau ihres Hauses am See zu überwachen, der von ein paar Collegestudenten aus Duluth durchgeführt wurde. Den ganzen Sommer lang beseitigten sie mit Baggern Gestrüpp, stellten Sperrholzwände auf, tackerten Schindeln an den Dachstuhl. Als das Haus fertig war, sah es anders aus als alles, was ich je in Loose River gesehen hatte. Es war mit Halbrundhölzern verkleidet und hatte riesige dreieckige Fenster, eine breite Veranda aus hellem Holz, die wie ein Schiffsbug auf den See hinausragte. Aus dem Kleinwagen hatte der Vater Adirondack-Stühle und gefügige Katzen herausgehoben: eine schwarz und dick, die andere weiß und kleidsam auf seinem Arm drapiert. Eines Nachmittags Ende August hatte ich sie auf ihrer neuen Veranda gesehen, von Kopf bis Fuß in Handtücher gewickelt. Vater, Mutter, winziges Kind. Das Handtuch des Kindes schleifte über die Holzplanken, und Mutter und Vater hatten sich beide gleichzeitig hingekniet, um es zu richten. Sie waren wie Bedienstete, die sich um eine sehr kleine Braut kümmerten, sie anschwärmten, ihr nicht von der Seite wichen. Sie schienen etwas sehr Liebes zu dem Kind zu sagen, das eine hohe, ängstliche Stimme hatte, die über Wasser trug. Seitdem hatte ich sie nicht mehr gesehen.
Doch an diesem Wintertag kamen sie zurück. Am Abend sah ich den Vater mit einem rosa Besen den Schnee von seiner Veranda fegen. Rauch waberte aus dem Schornstein. Am nächsten Nachmittag kamen die Mutter und das Kind in ihren Stiefeln und Schneeanzügen herausgewackelt. Der Junge bewegte sich unsicher über die frische Schneekruste, machte ein paar Schritte darauf, bis er einbrach. Als die Mutter ihn an den Achseln herauszog, wurden ihm die Stiefel von den Füßen gepflückt. Ich sah zu, wie die Mutter den armen Jungen hilflos in der Luft baumeln ließ, ohne zu wissen, ob sie ihn absetzen oder ihn so tragen sollte, in Socken über einem Universum aus Schnee hängend.
Was zum Teufel hat sie denn erwartet?, dachte ich spöttisch. Aber sie taten mir auch leid. So gut wie nichts auf dem See bewegte sich oder atmete. Es war der schlimmste Teil des Winters, eine weiße Wüste erstreckte sich in alle Richtungen, kein Ort für kleine Kinder oder Stadtmenschen. Unter dreißig Zentimeter tiefem Eis, unter meinen Stiefeln, trieben die Barsche dahin. Sie versuchten nicht zu schwimmen oder sonst irgendetwas zu tun, das irgendeine Anstrengung erforderte. Sie schwebten, warteten zusammen mit dem Treibholz darauf, dass der Winter vorüberging, schlugen kaum mit ihren Herzen.
Wir hatten uns auf mindestens einen weiteren Monat Winter eingestellt. Jeden Abend fütterte ich den Ofen in der Hütte, bevor ich die Leiter meines Hochbetts hinaufstieg, und an jedem schwarzen Morgen kratzte ich die Kohlenreste wieder zusammen und zündete mit trägen Fingern und ein paar Zedernspänen eine neue Flamme an. Wir hatten anderthalb Klafter Holz an der Außenwand der Hütte aufgestapelt, die ich mir gut einteilte. Wir stopften das Fensterfutter mit noch mehr Lappen aus, um die Wärme drinnen zu halten, ließen große Töpfe auf dem Ofen stehen, um morgens Schmelzwasser zu haben. Mein Vater hatte ein frisches Loch zum Angeln in das fast 45 Zentimeter starke Eis gebohrt.
Dann aber, Mitte März, schoss die Temperatur auf zehn Grad hoch, wo sie wundersamerweise auch blieb. Innerhalb von ein paar Wochen schrumpften die Schneewehen auf den Südseiten der Hänge zu Stalagmitensäulen zusammen. Ein nasser Schimmer erschien auf dem Eis, spätnachmittags konnte man den gesamten See knallen und zischen hören. Risse erschienen. Es war warm genug, um ohne Handschuhe Holz vom Stapel zu holen, um die Schnappverschlüsse an den Ketten der Hunde mit der Wärme der eigenen Finger zu enteisen. Auf der anderen Seite des Sees stellte die Familie ein Teleskop auf ihre Veranda – lang und speerförmig, auf den Himmel gerichtet. Unter dem Stativ stand ein Hocker, auf den sich das Kind manchmal abends stellte, um mit beiden in Fäustlingen steckenden Händen das Okular zu seinem Gesicht herunterzuziehen. Der Junge trug einen Schal, gestreift wie eine Zuckerstange, und eine rote Bommelmütze. Immer wenn der Wind auffrischte, tänzelte der Bommel in der Luft wie ein Köder beim Fischen.
Manchmal kam seine Mutter mit einer Skimütze auf dem Kopf heraus und justierte das Stativ neu, richtete das Rohr auf den Himmel und spähte selbst hindurch. Sie legte dem Jungen eine behandschuhte Hand auf den Kopf. Während sich der Abend zu seiner letzten Schattierung verdunkelte, sah ich sie dann wieder nach drinnen gehen. Ich sah, wie sie die Schals von ihren Hälsen wickelten. Ich sah, wie sie die Katzen knuddelten, sich die Hände unter dem Wasserhahn wuschen, Wasser in einem Kessel heiß machten. Offenbar hatten sie keine Jalousien vor...









