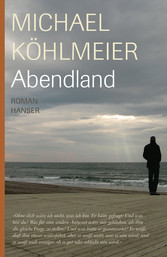
Abendland - Roman

von: Michael Köhlmeier
Carl Hanser Verlag München, 2012
ISBN: 9783446241978
Sprache: Deutsch
784 Seiten, Download: 4052 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Erstes Kapitel
1
Heute vor einem Jahr, am 18. April 2001, starb Carl Jacob Candoris. Er wurde fünfundneunzig Jahre alt. Bis zu seiner Emeritierung war er als Professor für Mathematik an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck tätig gewesen. In den letzten Jahren seines Lebens wohnte er in dem Dorf Lans oberhalb der Stadt in einer Villa am Fuß eines felsigen Hügels. Wenn er, wie er es liebte, auf der Wiese saß, in seinem von den Jahreszeiten versilberten Korbsessel, konnte er auf einen See und einen Berg sehen und hatte den Tannenwald im Rücken.
Wenige Wochen vor seinem Tod rief er mich an meinem Handy an und sagte: »Sebastian, bist es du?«
Und ich sagte: »Ja, ich bin es.«
Und er: »Deine Stimme klingt anders.«
Seine Stimme hatte den soliden, elastischen Tonfall, an den ich mich erinnerte, ironisch eingefärbt wie immer. Niemand hätte so eine Stimme einem Mann seines Alters zugetraut. Wir hatten uns zwei Jahre lang nicht mehr gesehen und auch nicht miteinander telefoniert; und das war eine ungewöhnlich lange Zeit.
»Ich habe«, sagte er, »gerade Inventur gemacht, und du bist der einzige Mensch von all jenen, die ich geliebt habe, der noch lebt.«
Ich dachte: So teilt er mir mit, daß er bald sterben wird. Als ich mein Handy zuklappte, geriet ich so sehr in Aufregung, daß ich der Schwester klingelte und sie bat, mir ein Beruhigungsmittel zu geben. Erst in der Nacht, als die Wirkung nachließ und ich auf den matten Lichtstreifen starrte, der das Fenster hinter den Vorhängen nachzeichnete, gestand ich mir ein: Nicht der Gedanke, daß mein Freund den Tod kommen sah, hatte mich derart aus der Fassung gebracht, sondern die absurde Empörung darüber, daß er überhaupt sterblich war.
Ich lag in Innsbruck im Krankenhaus, die Prostata war mir herausgeschnitten worden. Meine Stimme hörte sich in Folge der Intubationsnarkose wohl etwas rostig an. Bei einer routinemäßigen Blutuntersuchung im vorangegangenen November hatte der Computer ein Sternchen hinter meinen PSA-Wert gesetzt, was bedeutete, daß dieser zu hoch war. Eine Biopsie wurde durchgeführt, der Befund der histologischen Untersuchung war positiv: Krebs in einem frühen Stadium. Nach dem Autounfall vor fast zwanzig Jahren meinte ich nun zum zweitenmal in die schwarzen Augenringe zu blicken. Mein Arzt riet mir, mich in Innsbruck operieren zu lassen, dort habe man die besten Handwerker unter Vertrag.
Carl sagte, er habe gespürt, daß ich in seiner Nähe sei; inzwischen getraue er sich auch, seine Ahnungen vor sich selbst einzugestehen, er habe nicht mehr die voltairesche Kraft zu behaupten, er sähe nichts, wenn er über den Grenzbalken schaue; außerdem sei es beinahe schon unschicklich, in seinem Alter an der Vorbestimmtheit der Ereignisse zu zweifeln. Ich für mein Teil hatte im Zug nach Innsbruck an ihn gedacht; mit schlechtem Gewissen freilich, weil ich mich so lange nicht bei ihm gemeldet hatte, und mit dem bangen Gefühl, er könnte vielleicht gar nicht mehr am Leben sein; und: mit einer paradoxen vorauseilenden Enttäuschung – er könnte vor seinem Tod niemanden beauftragt haben, mich nach demselben zu informieren.
Nach zehn Tagen entfernte Dr. Strelka, mein Operateur, den Katheter, und ich wurde mit »den besten Aussichten auf Heilung« aus der Klinik entlassen. Ich fuhr hinauf nach Lans, und Carl und ich verbrachten unsere letzte gemeinsame Zeit. Ich richtete mich auf der Couch neben seinem Lehnstuhl ein; er erzählte, ich erzählte; wir hörten Musik und ließen uns von seiner Haushälterin und seiner Pflegerin verwöhnen. Letztere, Frau Mungenast, erlaubte ihm nur wenige Schritte, aber auf diese bestand er. Wenn er eine CD aus dem Regal nehmen wollte, faßte ich ihn an seinen Händen, die zart waren wie Reisig, und zog ihn aus seinem Sessel oder aus dem Rollstuhl hoch. Er dirigierte sich ins Gleichgewicht, wie ein Balanceur auf dem Hochseil; und stand schließlich, ruhig, gerade, als wäre er bereit, alle Ehren in Empfang zu nehmen. Sein Haar war weiß und noch voll und durchzogen von blaßgelben Streifen, die an seinen ehemaligen blonden Stolz erinnerten; stets hatte er es länger getragen, als es der Gepflogenheit seines jeweiligen Alters entsprach. Einen Meter neunzig war er groß, und nun, da er vom Alter und von seinen Leiden ausgezehrt war, erschien er mir größer denn je. In seinem hohen, schlanken, filigranen Körper war ein stählernes Gerüst eingesetzt. Hatte ich in den Jahren und Jahrzehnten denn nichts bemerkt? Irgendwann wurde dieser Körper nur noch von der Idee eines Stolzes gehalten. Die Muskulatur des Oberkörpers und der Oberarme bereitete ihm seit vielen Jahren Schmerzen. Anfänglich hatte er sich massieren und akupunktieren lassen, es hatte nichts genützt, und die Ärzte fanden nichts, und tatsächlich ergab sich keine Verschlechterung. Mehrere Jahre hatte er an einer chronischen Speiseröhrenentzündung herumlaboriert, Vernarbungen waren zurückgeblieben, das Essen wurde dadurch zu einem Problem. Er war an der Hüfte operiert worden, mehrere Male, schließlich war ihm ein Gelenkskopf aus Titan eingesetzt worden. Zwei Krebsoperationen hatte er hinter sich gebracht – mit sechzig Prostatektomie, zehn Jahre später schnitt man ihm ein Stück Dickdarm heraus. Aber hätte mich einer nach dem stärksten Mann gefragt, ich hätte geantwortet: der Professor Candoris. – So hatte ich ihn in Erinnerung. So habe ich ihn in Erinnerung: aufrecht, für Sekunden erstarrt, ehe er einen Gedanken in einen Satz faßte, der mir um so gewichtiger erschien, je nachlässiger er dahingesagt wurde. Zum Beispiel – nicht ganz willkürlich aus meinen Notizen gelesen: »Welchen Wert das Leben eines Menschen hatte, zeigt sich in dem Wert, den jene, die seinem Leben Wert gaben, ihm in ihrem eigenen Leben weiterhin beimessen.« Um einen gleich darauf anzublicken und mit den Mundwinkeln zu zucken – als schäme er sich, daß ihm wieder einmal nur ein Zopf von einem Satz gelungen war; aber auch, als amüsiere er sich über unsere Begriffsstutzigkeit, die er wieder einmal aus ihrer Tarnung gelockt hatte.
Carl war ein sehr reicher Mann; er war – wie ich im Verlauf der Recherche zu diesem Buch bestätigt bekommen habe – Erbe der Feinkost-, Süßwaren- und Kolonialwarenkette Bárány & Co. (das ist nach seinem Großvater Ludwig Bárány), die in mehreren Städten in Europa Kontore und Läden unterhielt oder an solchen beteiligt war. Vieles hatte er verkauft, nicht, weil er das Geld gebraucht hätte, als Universitätsprofessor verdiente er ja auch nicht schlecht, sondern weil er es irgendwann leid war, sich um die Geschäfte zu kümmern. Er war der großzügigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er legte Wert auf gute Kleidung, bevorzugte Anzüge aus Flanell in den Farben des Herbstes und hatte nie das Haus verlassen, ohne sich eine Krawatte umzubinden. Und so hielt er es auch, als ich ihn – sobald es meine Kräfte zuließen – im Rollstuhl ins Dorf und zum Friedhof vor das Grab von Margarida schob, die dort seit neunzehn Jahren lag, oder wenn ich mit ihm, wie es bald unsere tägliche Gewohnheit wurde, durch den Schneematsch an der Lanserbahn entlangfuhr und über die langen flachen Stufen hinunter zum Lansersee. Sein Mantel mit dem eingeknöpften Winterfutter war mir vertraut wie ein eigenes Kleidungsstück; ich kannte ihn seit meiner Kindheit, er hatte sich immer wieder neue Stücke anfertigen lassen, jedes nach dem Muster des ersten. Wir haben uns übrigens nie umarmt. Daß er mich mit den Händen bei den Oberarmen hielt, das schon. Sein Spezialgebiet war die Zahlentheorie gewesen, über die er einmal sagte, sie sei »schön und ohne Sinn wie das Leben und wie dasselbe bestehend aus einer Aufeinanderfolge von Problemen und Lösungen, was, weil die Aufeinanderfolge sich unendlich fortsetzt, schließlich auch den Begriffen Lösung und Problem jeden Sinn nimmt«.
Zwanzig Tage blieb ich bei ihm. Dann fuhr ich zurück nach Wien und hörte seine Stimme nie mehr wieder. Ich rief bei ihm an, Mobil und Festnetz; er nahm nicht ab. Mehrmals am Tag rief ich an; ich sprach auf den Anrufbeantworter, bat ihn, mich zurückzurufen. Er rief nicht zurück. Schließlich erhielt ich einen Anruf von seiner Pflegerin Frau Mungenast. Sie teilte mir mit, daß Professor Candoris am Abend in seinem Bett eingeschlafen und am Morgen nicht mehr aufgewacht sei.
Mein Name ist Sebastian Lukasser. Ich bin Schriftsteller, zweiundfünfzig Jahre alt und lebe in Wien, allein; unterhalte eine Beziehung zu einer Frau, die achtzehn Jahre jünger ist als ich und die das, was wir miteinander haben und was wir füreinander sind, genau so bezeichnet hat, nämlich als Unterhaltung – wogegen ich viel einzuwenden hätte, allerdings nicht das, was sie sich erhofft.
Vor langer Zeit war ich verheiratet. Ich habe einen Sohn; er wohnt bei seiner Mutter in Frankfurt; vor einem Jahr hat er mich besucht, da hat er mich zum erstenmal aus bewußten Augen angeschaut. Wir saßen zusammen in meiner Küche, als Frau Mungenast anrief.
Meine Mutter lebt noch, mein Vater nicht mehr. Meine Mutter habe ich fünfzehn Jahre lang nicht gesehen, erst wieder bei Carls Beerdigung. Dieses Buch wird auch das Resümee meiner Familie werden, und ich befürchte, ich trete damit für immer aus ihr heraus; was natürlich eine Illusion ist, denn unsere Familie hat bereits mit Carls Tod aufgehört zu existieren.
Carl hatte nie viel übrig gehabt für Gesprächsverzierungen. Ich war noch keine fünf Minuten in Lans, hatte das Haus noch gar nicht betreten – wir saßen in der Februarsonne im Schutz des an der Wand aufgestapelten Brennholzes –, da kam er bereits auf das Wesentliche – sein Wesentliches! – zu sprechen, nämlich, daß er mehr von mir wolle, als daß ich ihm lediglich...









