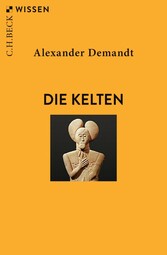
Die Kelten
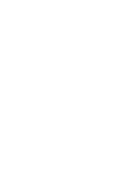
von: Alexander Demandt
Verlag C.H.Beck, 2021
ISBN: 9783406769160
Sprache: Deutsch
130 Seiten, Download: 2717 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
2. Ursprung und Quellen
Unser Wissen über die Kelten beziehen wir in erster Linie aus den griechischen und römischen Schriftstellern. Anlaß für die Berichterstattung sind in der Regel kriegerische Begegnungen. Die ältesten Nachrichten stammen von zwei Historikern aus dem griechischen Kleinasien, Hekataios von Milet und Herodot von Halikarnassos. Hekataios schrieb in der Zeit um 500 v. Chr., er nennt das Hinterland der ligurischen Küste und von Marseille – griechisch Massalia, lateinisch Massilia – Keltikê (gê), «keltisches Land», wo auch die Stadt Nyrax liege. Mit einiger Wahrscheinlichkeit läßt sich Nyrax mit dem Königreich Noricum in Kärnten und Steiermark gleichsetzen, so daß damals der Alpenraum und das Rhônetal als keltisch angesprochen werden dürfen.
Herodot (II 33; IV 49) überliefert aus der Zeit um 450, der Istros, d.h. die Donau, entspringe im Lande der Kelten, bei der Stadt Pyrene. Meint er hier die Pyrenäen? Sie wären dann aus seiner Perspektive mit dem Schwarzwald verschmolzen. Die Kelten lebten, so schreibt er, wohl nach karthagischen Quellen, außerhalb der Säulen des Herakles – wenn man sie nämlich zu Schiff erreichen wollte, denn das Hinterland von Marseille war von Ligurern bewohnt. Das waren dann die keltisch geprägten Lusitanier in Portugal. Demnach besiedelten die Kelten um 500 v. Chr. das Voralpenland, das mittlere Frankreich und das Küstengebiet am Atlantik.
Unter den späteren Autoren griechischer Zunge berichten über die Kelten insonderheit Polybios in seinem um 150 v. Chr. abgefaßten, großenteils verlorenen Geschichtswerk; der Stoiker Poseidonios, der um 90 v. Chr. Gallien und Spanien bereist hat, dessen griechisch verfaßte Völkerkunde von Diodor benutzt wurde, sonst jedoch nur in Zitaten erhalten ist; weiterhin der unter Augustus schreibende Geograph Strabon, der Reiseschriftsteller Pausanias aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. und die Enzyklopädie antiker Tafelkultur des Athenaios aus Naukratis in Ägypten, verfaßt um 200 n. Chr.
Die lateinischen Literaten überragt Caesar, der uns in seinen eingangs erwähnten sieben Büchern «De bello Gallico» ausführlich und verläßlich über das keltische Stammeswesen unterrichtet, vor allem in seinem Gallier-Exkurs (VI 11–20). Dieses Werk ist gemeint, wenn, wie hier, hinter Caesars Namen Buchnummer und Paragraph in Klammern zitiert werden. Caesar hat als Prokonsul 58 bis 51 v. Chr. Gallien erobert und Land und Leute dabei gründlicher kennengelernt als irgend jemand vor ihm. Trotz des immer wieder erhobenen und stellenweise begründeten Vorwurfs einer déformation historique (Rambaud 1966) einer prorömischen Tendenz bleibt Caesar als Quelle unersetzbar. Einzelne Meldungen aus zweiter Hand verdanken wir weiterhin den unter Augustus entstandenen lateinischen Geschichtswerken von Livius, Pompeius Trogus beziehungsweise Justin, Tacitus (um 100) und Ammianus Marcellinus (um 400).
Caesar ist der erste antike Autor, der zwischen Kelten und Germanen unterschieden hat. Seinem Exkurs über die Gallier folgt ein solcher über die Germanen. Vor der Zeit Caesars herrschte die Ansicht, daß West-, Mittel- und Nordeuropa ausschließlich von keltischen Stämmen bewohnt seien. Es ist möglich, daß bereits Poseidonios den Unterschied erkannt hat, da er die Sprache der germanischen Teutonen anscheinend nicht als gallisch betrachtete. Die ursprüngliche Gleichsetzung der beiden Völker beruhte auf der weitgehenden Übereinstimmung in Wesensart und Lebensform, auf ihrer Nachbarschaft und darauf, daß der Name Germani höchstwahrscheinlich eine keltische Fremdbenennung für die sich selbst als Sweben bezeichnenden Völker rechts des Rheins darstellt. Der Name Germani findet sich für zwei rein keltische Stämme an der oberen Rhône und in Spanien. Obschon die Verschiedenheit von Kelten und Germanen seit Caesar und erst recht seit der «Germania» des Tacitus jedem Römer bekannt sein konnte, haben einzelne Autoren bis in die byzantinische Zeit die Germanen als «Barbaren des Nordens» zu den Kelten gerechnet, so Appian, Cassius Dio und das große byzantinische Lexikon aus dem 10. Jahrhundert, die Suda.
Der nach antiker wie moderner Ansicht entscheidende Grund für die Verschiedenheit von Kelten und Germanen liegt in der Sprache. Das Keltische, das in ganz Gallien gesprochen wurde, ebenso in Britannien und Galatien, gehört zu den 1810 von dem Dänen Conrad Malte Brun so benannten indogermanischen Sprachen. Wir besitzen aus der Antike keine längeren keltischen Texte, nur etwa 60 Inschriften der vorchristlichen Zeit. Dazu kommen Namen auf Münzen und Glossen antiker Autoren sowie Personen- und Ortsnamen. Keltische Namen für Flüsse, Berge, zuweilen auch Siedlungen begegnen in einem Gebiet, dessen Nordgrenze vom Niederrhein über das keltische «Eisenach» bis nach Böhmen verläuft. Keltisch oder vorkeltisch sind die Namen vieler deutscher Flüsse, so die von Rhein, Lippe, Ruhr, Lahn, Main, Nidda, Neckar und Tauber. Auch Donau, Isar und Lech tragen keltische Namen. Der Gesamtraum keltischer Ortsnamen greift dann aus über ganz Frankreich, nach Mittelspanien und Britannien.
Die Sprachwissenschaft unterscheidet zwischen zwei Formen des Keltischen, dem Q-Keltischen und dem P-Keltischen. Q-Keltisch hat beispielsweise die Form equos für Pferd, P-Keltisch die Form epos. Wir finden im Kernraum, das heißt in Gallien und England mit Wales und Cornwall, aber auch in Galatien das P-Keltische, durchsetzt mit wenigen Resten von Q-keltischen Ortsnamen (Sequana – Seine), während in Irland, Schottland und in Spanien das Q-Keltische herrschte, das als Gälisch oder Goidelisch bis in die Gegenwart in Irland mehr gepflegt als gesprochen wird. Das Q-Keltische zeigt engere Verwandtschaft zum Lateinischen (equus), und das erlaubt den Schluß, daß das Q-Keltische die ältere Variante ist, die aus dem späten 2. Jahrtausend stammt, als Urkelten und Uritaliker noch Nachbarn in Mitteleuropa waren. Im Zentralraum hat sich die Sprache zum P-Keltischen fortgebildet, ohne daß die konservativen Randzonen dieser Entwicklung gefolgt wären. Eine verwandte Erscheinung zeigt das kanadische Französisch, wo sich Eigenarten gehalten haben, die im Mutterland verschwunden sind.
Aus der Zeit und dem Raum, für welche eine keltische Besiedlung bezeugt ist, stammt ein geschlossener Komplex gleichartiger Bodenfunde, der seit 1872 nach einer fundreichen Sandbank im Neuenburger See in der Westschweiz als Latène-Kultur bezeichnet wird. Es ist die jüngere, von 450 v. Chr. bis zur Römerzeit gerechnete Eisenzeit. Sie bildet den Abschluß der Urgeschichte in Mitteleuropa. Da die Latène-Kultur sich kontinuierlich aus der Hallstatt-Kultur, benannt nach dem wichtigsten Ort des keltischen Salzbergbaus im Salzkammergut, d.h. aus der älteren Phase der Eisenzeit, heraus entwickelt hat, werden auch bereits deren Träger als Kelten angesprochen. Die Hallstatt-Kultur umspannt in Süddeutschland die Zeit von etwa 800 bis 450 v. Chr.
Die Kelten der Hallstatt- und Latène-Zeit sind archäologisch sehr gut bezeugt. Wir kennen zahlreiche Höhensiedlungen (oppida), denken wir an den Mont Auxois (das antike Alesia), den Mont Beuvray (das antike Bibracte), an die Heuneburg bei Hundersingen an der oberen Donau oder den Glauberg in der hessischen Wetterau. Die wichtigsten Funde lieferten unberaubte Fürstengräber, darunter das um 480 v. Chr. angelegte, 1953 aufgedeckte Hügelgrab von Vix beim oppidum Mont Lassois mit reichstem Inventar, ausgestellt in Châtillon-sur-Seine, weiterhin der 1977 entdeckte Tumulus von Hochdorf beim oppidum Hohenasperg aus der Zeit um 540 v. Chr. mit kostbaren Beigaben, heute im Landesmuseum Stuttgart, sowie das Grab vom Glauberg mit der berühmten Statue, entdeckt 1994, aus dem 5. Jahrhundert. Die Zahl der hallstattzeitlichen Grabhügel allein in Württemberg wird auf fast 7000 geschätzt.
Für die weiter zurückliegenden Perioden werden die Annahmen über das, was «keltisch» heißen darf, ungewisser. Ob die der Hallstatt-Zeit vorausgegangene Urnenfelder-Bronzezeit (1200 bis 800 v. Chr.) oder gar die davor anzusetzende Hügelgräber-Bronzezeit (1500 bis 1200 v. Chr.) bereits von keltisch Sprechenden getragen wurde, bleibt umstritten. Der Begriff «Protokelten» ist eine Verlegenheitslösung. Nach der herrschenden Ansicht ist die Ausbreitung der Urnenfelder um 1100 v. Chr. mit der Wanderung der Indogermanen nach Westen gleichzusetzen.
Der Historiker steht bei den Kelten vor demselben Problem, das mit der...









