
Verhaltenslehren der Kälte - Lebensversuche zwischen den Kriegen
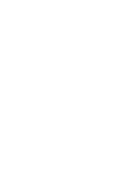
von: Helmut Lethen
Suhrkamp, 2022
ISBN: 9783518773048
Sprache: Deutsch
300 Seiten, Download: 1633 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
7Einleitung
»Die Kältetendenz rührt vom Eindringen der Physik in die moralische Idee.«
Ossip Mandelstam, 1930
I
In Augenblicken sozialer Desorganisation, in denen die Gehäuse der Tradition zerfallen und Moral an Überzeugungskraft einbüßt, werden Verhaltenslehren gebraucht, die Eigenes und Fremdes, Innen und Außen unterscheiden helfen. Sie ermöglichen, Vertrauenszonen von Gebieten des Mißtrauens abzugrenzen und Identität zu bestimmen.
Die zwanziger Jahre sind ein Augenblick tiefwirkender Desorga- nisation. Vertraute Orientierungsmuster der wilhelminischen Gesellschaft haben keine Geltung mehr. Drei Nachkriegsjahre mit immer wieder aufflackerndem Bürgerkrieg und die Erfahrung der Inflation werden in einer Phase der Stabilisierung von Wirtschaft und Politik aufgefangen, deren provisorischer Charakter den Zeitgenossen von beinahe allen Parteien eingeschärft wird. Unter der radikalen Intelligenz hat die Demokratie wenig Freunde. Man trifft auf viele Zeugnisse des Bewußtseins, zwischen Kriegen zu leben.
Es ist das Verhängnis der Republik, daß sie in einem Zeitraum improvisiert werden soll, in dem die Erfahrung mit dem Weltkrieg verarbeitet werden muß. Die »Schmach« der Niederlage erschwert die Überleitung der Kriegsgesellschaft in eine Friedensgesellschaft. 6 Millionen demobilisierte Deutsche müssen in zivilen Institutionen aufgefangen, 2,7 Millionen Kriegsinvalide versorgt werden.
Der Krieg hat die Einsicht der pessimistischen Anthropologie gefördert, daß der Mensch »von Natur aus« zur Destruktion neigt und die Zivilisation einen barbarischen Kern hat. In dieser Situation sind die Beiträge, mit denen sich der philosophische Anthropologe Helmuth Plessner in die politische Diskussion einmischt, Vorschläge zu einer Verhaltenslehre.
Eine Schrift aus dem Jahre 1924, Helmuth Plessners Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus, erlangte in den vergangenen Jahren besondere Aufmerksamkeit. Die Über8schriften der Artikel, die ihr gewidmet wurden – »Vom Recht auf Maske«, »Souverän im Ausdruck«, »Die Grenzen der Gemeinschaft« –, sind ebenso programmatisch wie die Titel der Bücher Die Sucht mit sich identisch zu sein und Der Betroffenheitskult, die unter ihrem Einfluß geschrieben sind.1 Gegenwärtig werden Maximen von Plessners Verhaltenslehre aufgegriffen, um sie gegen Einstellungen zu wenden, in denen man den Mangel an politischer Kultur in der Bundesrepublik verkörpert sieht: gegen den Kult der Aufrichtigkeit und Gesinnungsethik, gegen die Ideologie der unentfremdeten Leiblichkeit und die Klage über den Verlust einer authentischen Gemeinschaft. Alle Kombattanten haben sich von einem Argument überzeugen lassen, das Plessner in der Verspäteten Nation 1935 formulierte: Der Mangel an politischer Kultur rühre von dem historischen Unglück, daß der entscheidende adelig-bürgerliche Zivilisationsschub der Frühen Neuzeit in Deutschland in eine Epoche konfessioneller Kriege und wirtschaftlichen Niedergangs gefallen sei. Plessners Schrift von 1924 wird als kühnes Denkexperiment gewürdigt, mit der Aufwertung von Diplomatie, Takt, Zeremonie und Prestige das in Deutschland versäumte 17. Jahrhundert Europas nachzuholen, »in dem sich in der Angleichung von Adelsethos und Bürgersinn verhaltenssichere Führungsschichten der neuen westeuropäischen Nationalstaaten gebildet« hätten.2 In der Tat findet man in Plessners Schrift eine für die Tradition deutschen Denkens ganz außerordentlich positive Haltung zur »Öffentlichkeit«. Traditionell negativ bewertete Merkmale wie Anonymität, Aufenthaltslosigkeit, Zerstreuung und Seinsentlastung werden von Plessner als Möglichkeitshorizont begrüßt, ohne den sich eine Existenz nicht auf spezifisch humane Weise verwirklichen kann. Er teilt zwar die Einschätzung der Öffentlichkeit als Mißtrauenssphäre, die Heidegger in Sein und Zeit beschreibt – »Das Miteinander im Man ist ganz und gar nicht ein abgeschlossenes, gleichgültiges Nebeneinander, sondern ein gespanntes, zweideutiges Aufeinander-aufpassen, ein heimliches Sich-gegenseitig-abhören. Unter der Maske des Füreinander spielt ein Gegeneinander« –, begreift diese agonale Sphäre aber als notwendige Umwelt, der ein Subjekt »zugerechnet« werden muß.3 Gegen den Gemeinschaftskult preist er die Lebenskunst der Entfremdung. Es geht um die Erlernung von Techniken, »mit denen sich die Menschen nahe kommen, ohne sich zu treffen, mit denen sie sich von einander entfernen, ohne sich durch Gleichgül9tigkeit zu verletzen«.4 Es gilt, die Künstlichkeit der Gesellschaftsformen als natürliches Milieu des Verhaltens zu erschließen, um die in der deutschen Kultur versäumte Verhaltenssicherheit zu gewinnen. Dann wird »die erzwungene Ferne von Mensch zu Mensch zur Distanz geadelt, die beleidigende Indifferenz, Kälte, Roheit des Aneinandervorbeilebens durch Formen der Höflichkeit, Ehrerbietung und Aufmerksamkeit unwirksam gemacht und einer zu großen Nähe durch Reserviertheit« entgegengewirkt.5 Das zivilisierte Verhalten der Distanz bedarf nicht der Verwerfung einer »authentischen« Natur; denn der Mensch ist von Natur aus künstlich! Man kann die Radikalität dieses Grundsatzes von Plessners Anthropologie zu diesem Zeitpunkt nicht hoch genug veranschlagen. Künstlichkeit als genuines Medium humanen Verhaltens – das ist ein Axiom, mit dem das Polaritätsdenken der Lebensphilosophie über Nacht umgewertet wird. Die polare Spannung, in die eine ganze Epoche Triebregung und sozialen Zwang, unentfremdetes Sein und Verdinglichung, authentischen Ausdruck und verhaltene Konvention versetzt hatte, wird zwar nicht plötzlich aufgehoben, aber doch so gewendet, daß Entfremdungs-Kälte der »Gesellschaft« als Lebenselixier denkbar wird.
An dieser Stelle müßte man freilich eine deutsche Sonderbarkeit bemerken: mußte erst eine fundamentale Anthropologie entworfen werden, um Einverständnis mit zivilisatorischem Verhalten zu begründen? Sollte man sich in Ermangelung einer entlastenden Tradition mit einer Naturgrundlage versorgen? Ist der Hang zum »Exzentrischen« in Plessners Anthropologie etwa das Symptom der Aufholjagd, deren Notwendigkeit er so glänzend diagnostiziert? Wie kommt es, daß heute seine Anthropologie ganz selbstverständlich wie ein Kompendium nobler Verhaltensregeln gelesen wird?
II
Der Aktualisierung von Plessners Maximen möchte diese Arbeit mit dem Verfahren der Historisierung antworten – in der Gewißheit, wieviel diese dem aktuellen Handgemenge verdankt. Historisierung meint, daß ich den Habitus des Subjekts der Verhaltenslehre der Kälte im Umfeld seiner Handlungsmöglichkeit und im Horizont seiner »vergangenen Zukunft« rekonstruiere und daß ich 10den Aspekt der Fremdheit des Sinnzentrums, um das sich die Welt der »kalten persona« dreht, betone. Dabei sollen die ungeheuren Chancen, die in den Denkexperimenten der zwanziger Jahre liegen, nicht verdunkelt werden. Die Historisierung macht verständlich, warum sich die deutschen Spielarten der Verhaltenslehren der Distanz nie frei machen konnten von Anflügen des »Heroismus«, warum sie entweder mit der asketischen Haltung »selbstgewählter Unseligkeit« oder dem Amoralismus des Dandy-Soldaten aufgetreten sind – und warum sie das Sich-Einlassen mit dem Zivilisatorischen als Element eines »Kults des Bösen« begriffen, als sei ihre freundliche Verhaltenslehre eine »Inversion der Heilsgeschichte«, von der sie sich nur unter Schmerzen trennten.6
Die ersten beiden Kapitel verzögern ein wenig die Geschichte vom Schicksal der Verhaltenslehre der Kälte, die im III. Kapitel erzählt wird. Sie skizzieren Rahmenbedingungen der Verhaltenslehren der »Republik ohne Gebrauchsanleitung« (Alfred Döblin). Das I. Kapitel macht, mit einem Modell der »Schamkultur«, das in der kulturellen Anthropologie der dreißiger Jahre entwickelt wurde, Einstellungen der zwanziger Jahre verständlich. Die in...









