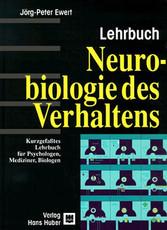
Neurobiologie des Verhaltens
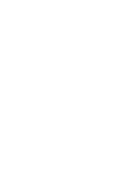
von: Jörg-Peter Ewert
Hogrefe AG, 1998
ISBN: 9783456929941
Sprache: Deutsch
304 Seiten, Download: 4195 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
| Inhaltsverzeichnis | 6 | ||
| Vorwort | 12 | ||
| Ein einführender Dialog | 14 | ||
| Kapitel 1: Aufgaben der Neurobiologie | 20 | ||
| 1.1 Warum ist Neurobiologie wichtig? | 20 | ||
| Regeneration und Evolution | 20 | ||
| Gibt es einen Weg aus dem Rollstuhl? | 20 | ||
| Degeneration und Zelltod | 20 | ||
| Wer rastet, der rostet? | 21 | ||
| «Augenwesen»: Von der Kröte zum Menschen | 21 | ||
| Realität und Einbildung | 22 | ||
| Raumverteilung im Cortex: Regelt die Nachfrage das Angebot? | 22 | ||
| Demokratie oder Hierarchie? | 22 | ||
| Sicherungen der Aggression | 23 | ||
| Junge oder Mädchen? | 23 | ||
| Streß beeinflußt die Körperabwehr | 23 | ||
| Kampf der Angst | 24 | ||
| Belohnung für das Belohnungssystem | 24 | ||
| Probleme mit den Fettreserven | 25 | ||
| Bei allen tickt die gleiche Uhr | 25 | ||
| Wie künstlich ist künstliche Intelligenz? | 25 | ||
| 1.2 Methoden der Neurobiologie | 26 | ||
| Grundlagenforschung | 26 | ||
| Studien am Menschen | 27 | ||
| Elektroenzephalogramm, EEG und Ereignis-korreliertes Potential, EKP | 27 | ||
| Bildgebende Verfahren | 29 | ||
| Bildgeführte Neurochirurgie | 31 | ||
| 1.3 Historische Zeittafel der Neuro- und Verhaltensbiologie | 31 | ||
| 1.4 Literatur | 35 | ||
| Kapitel 2: Phylogenese und Ontogenese: Was Menschen und Tiere verbindet | 40 | ||
| 2.1 Prinzipien der Evolution | 40 | ||
| Verwandtschaftsbeziehungen | 40 | ||
| Natürliche Selektion und Fitness | 40 | ||
| Kosten/Nutzen-Prinzip | 43 | ||
| Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts | 44 | ||
| Konservierte Eigenschaften in Nervensystemen | 47 | ||
| Gehirngliederung | 48 | ||
| Konservierte Gene für Gehirngliederung | 49 | ||
| 2.2 Generation, Regeneration, Neuroprotektion | 50 | ||
| Induktion | 50 | ||
| Interaktionen zwischen Neuroglia und Neuronen | 51 | ||
| Axonales Wachstum | 51 | ||
| Verkabelung im Rückenmark | 52 | ||
| Neuromuskuläre Kontakte | 54 | ||
| Plastizität der Muskelsynapse | 54 | ||
| Axonales Wachstum bei der Regeneration | 55 | ||
| Das Problem mit der Glia | 56 | ||
| Nerven-Bypass nach Rückenmarksfraktur | 56 | ||
| 2.3 Altern und Zelltod | 57 | ||
| Frage altersbedingten Neuronenverlusts | 57 | ||
| Alters-Gene | 58 | ||
| Altern und Streßtoleranz | 59 | ||
| Hormonspiegel und Altern | 59 | ||
| Programmierter Zelltod | 60 | ||
| Schlaganfall: Wenn PCD fehlgestartet wird | 61 | ||
| Hirnfunktionen nach Herzstillstand | 62 | ||
| Alzheimersche Krankheit | 62 | ||
| Prionen | 64 | ||
| 2.4 Abstammung des Menschen und Entwicklung der Großhirnrinde | 64 | ||
| Der prähistorische Mensch | 64 | ||
| Evolution der Intelligenz | 65 | ||
| Corticales Entwicklungspotential | 66 | ||
| Ursprung des Neocortex | 67 | ||
| Mechanismen der Cortexvergrößerung | 68 | ||
| Genetische Steuerung der Cortex-Entwicklung | 70 | ||
| «Handreich»-Hypothese der thalamo-corticalen Verknüpfung | 71 | ||
| 2.5 Ontogenese und Phylogenese von Cortexarealen | 72 | ||
| Das topographische Prinzip | 72 | ||
| Wie entwickeln sich corticale Projektionen? | 73 | ||
| Primäre und zusätzliche corticale Areale | 73 | ||
| Evolution zusätzlicher corticaler Areale | 74 | ||
| 2.6 Umwelteinflüsse prägen sensorische Systeme | 75 | ||
| Aktivitätsabhängige Ausprägungen | 75 | ||
| Monokulare Deprivation | 75 | ||
| Binokulare Koinzidenz | 76 | ||
| Monoton strukturierte Umgebung | 77 | ||
| Visuomotorische Interaktionen | 78 | ||
| 2.7 Zur Stammes- und Entwicklungsgeschichte halten wir verschiedene Punkte fest: | 79 | ||
| 2.8 Literatur | 80 | ||
| Kapitel 3: Wie Gehirne Signale ihrer Umgebung erschließen | 84 | ||
| 3.1 Signale und Auslösemechanismen | 84 | ||
| Umwelten | 84 | ||
| Auslösemechanismen | 85 | ||
| Motivation, Kontext, Konvention | 86 | ||
| 3.2 Schlüsselreize und der Gestalt-Begriff | 87 | ||
| Gestalt | 87 | ||
| Kategorie und Invarianz | 87 | ||
| 3.3 Vom AM-Konzept zum neurophysiologischen Korrelat | 89 | ||
| Das Problem mit dem Schlüssel | 89 | ||
| Gibt es Kommando-Neurone? | 89 | ||
| Parallelverarbeitende Kommandosysteme | 89 | ||
| 3.4 Fallstudie: Wie analysiert ein Krötenhirn visuelle Objekte? | 90 | ||
| Verhaltenssequenzen | 90 | ||
| Merkmalsbeziehungs-Algorithmus | 90 | ||
| Angeboren oder erlernt? | 91 | ||
| Neurophysiologische Korrelate | 92 | ||
| Selektivität durch neuronale Interaktion | 94 | ||
| Starthilfe | 94 | ||
| Aufmerksamkeit | 95 | ||
| Einflüsse durch Lernen | 95 | ||
| Auslösesysteme | 95 | ||
| Modifikation von Verhaltensstrategien | 97 | ||
| 3.5 Wahrnehmung im Sehsystem der Primaten | 98 | ||
| Optische Täuschung als «sichtbare» Informationsverarbeitung | 98 | ||
| Retinale On- und Off-Zentrum-Neurone | 98 | ||
| Laterale Inhibition | 99 | ||
| Farbkontrastempfindliche Ganglienzellen | 100 | ||
| Verbindungen vom Auge zum Gehirn | 100 | ||
| Augendominanz-Kolumnen | 102 | ||
| Orientierungs-Kolumnen | 103 | ||
| Blobs | 103 | ||
| Kanten-Detektion | 103 | ||
| 3.6 Integrative visuelle Leistungen bei Primaten | 104 | ||
| Das «Was»-System | 104 | ||
| Das «Wo-und-Wie»-System | 107 | ||
| Auswirkungen von Hirn-Läsionen beim Menschen | 108 | ||
| Das «duale» Sehsystem des Menschen | 110 | ||
| Stellenwert der Bewegungswahrnehmung | 110 | ||
| Bewußte visuelle Wahrnehmung | 111 | ||
| Wahrnehmung und Einbildung | 111 | ||
| Sensorische Substitution | 112 | ||
| Re-Modelling | 113 | ||
| Exkurs: Phantomschmerzen | 114 | ||
| 3.7 Zur Wahrnehmung von Signalen halten wir verschiedene Punkte fest: | 115 | ||
| 3.8 Literatur | 116 | ||
| Kapitel 4: Wirkungsgefüge der Verhaltensmotivationen | 120 | ||
| 4.1 Was ist Motivation? | 120 | ||
| Ein klassisches Verhaltensexperiment | 120 | ||
| Definitionen | 120 | ||
| 4.2 Hunger und Sättigung | 120 | ||
| Kontrolle des Blutzuckerspiegels | 120 | ||
| Gibt es Appetit-Zentren? | 121 | ||
| Das Sollwertkonzept | 122 | ||
| Das Leptin/Neuropeptid-Y-System | 123 | ||
| Appetitzügler | 124 | ||
| Eßstörungen | 124 | ||
| 4.3 Durst Osmometischer Durst | 125 | ||
| Hypovolämischer Durst | 125 | ||
| 4.4 Sexualmotivation | 126 | ||
| Sexuelle Festlegung | 126 | ||
| Männliche Differenzierung | 126 | ||
| Weibliche Differenzierung | 128 | ||
| Gendefekte und Sexualität | 128 | ||
| Genomische Prägung | 130 | ||
| Einfluß von Sexualhormonen auf das Gehirn | 130 | ||
| Prinzip der Sparsamkeit | 130 | ||
| Sexuell dimorpher Nucleus | 131 | ||
| Cerebrale Steuerung des Paarungsverhaltens | 131 | ||
| Geschlechtsspezifische Unterschiede und sexuelle Orientierung | 132 | ||
| Sexualdimorphismus der Vokalisation | 133 | ||
| Pflegeverhalten bei der Aufzucht | 134 | ||
| Frühe Erfahrungen und Partnerwahl | 135 | ||
| Sexualpheromon-Prägung | 135 | ||
| Körpergeruch und Sex | 136 | ||
| 4.5 Aggressivität | 137 | ||
| Auslöser und Verhaltensmuster | 137 | ||
| Cerebrale Repräsentation | 138 | ||
| Angriffsverhalten | 138 | ||
| Vokale Aggression | 138 | ||
| Funktionsebenen der Vokalisation | 139 | ||
| Psychochirurgie | 141 | ||
| 4.6 Sozialer Streß | 141 | ||
| Stressoren und Streßachsen | 141 | ||
| Dauerstreß | 142 | ||
| Therapeutischer Einsatz von Cortison | 142 | ||
| Streß-Reaktionstypen | 142 | ||
| Soziale Bindung | 143 | ||
| Populationsdichte | 143 | ||
| Dominanzbeziehungen | 144 | ||
| Sieger-Typen | 144 | ||
| Verlierer-Typen | 145 | ||
| Rangordnung und Streß | 145 | ||
| Streßachsen und Streßtypen | 146 | ||
| 4.7 Streß und Immunsystem | 146 | ||
| Antigene und Leukozyten | 146 | ||
| Freßzellen und Antikörper | 148 | ||
| Immunantworten und Immunisierungen | 148 | ||
| Monoklonale Antikörper | 148 | ||
| Zell-vermittelte Immunprozesse | 149 | ||
| Immunschutz des Nervensystems | 149 | ||
| Autoimmun-Reaktionen | 150 | ||
| Beziehungen zwischen Nervensystem und Immunsystem | 151 | ||
| Beziehungen zwischen Streß- und Immunsystem | 151 | ||
| Konditionierte Immunantworten | 153 | ||
| 4.8 Zur Verhaltensmotivation halten wir verschiedene Punkte fest: | 154 | ||
| 4.9 Literatur | 155 | ||
| Kapitel 5: Emotionen und Stimmungen: Euphorie, Depressionen, Angst, Sucht, Innere Uhr | 158 | ||
| 5.1 Entdeckung der Belohnungs- und Bestrafungssysteme | 158 | ||
| Stimmungen | 158 | ||
| Hirn-Selbstreizungsversuche | 158 | ||
| Belohnung und Dopamin | 158 | ||
| 5.2 Störung neurochemischer Gleichgewichte durch Drogen | 160 | ||
| Cocain | 160 | ||
| Was ist Sucht? | 161 | ||
| Dopamin und Cocain-Sucht | 161 | ||
| Marihuana | 162 | ||
| Amphetamin und Designer-Drogen | 162 | ||
| Nikotin | 164 | ||
| 5.3 Opiatsucht | 164 | ||
| Opiatsysteme | 164 | ||
| Neurobiologische Korrelate der Opiatsucht | 165 | ||
| Methadon-Substitution | 165 | ||
| Verschiedene Formen der Sucht, derselbe Mechanismus? | 166 | ||
| 5.4 Störung neurochemischer Gleichgewichte durch Krankheit | 166 | ||
| Schizophrenie | 166 | ||
| Exkurs: Sinnestäuschungen | 167 | ||
| Probleme der Wahrnehmung und Zuordnung | 167 | ||
| Antischizophrenika | 168 | ||
| 5.5 Angst | 169 | ||
| Schreckreflexe | 169 | ||
| Konditionierte Angst | 169 | ||
| gesteuert werden. Die sympathischen GABA-Bremse und Tranquilizer | 169 | ||
| GABA-Bremse und Glutamat-Beschleuniger | 170 | ||
| Depressionen | 170 | ||
| Pharmakologische Nebenwirkungen | 172 | ||
| Angst-Lust | 172 | ||
| 5.6 Lebensgewohnheiten und Neurotransmitter | 173 | ||
| Cheeseburger-Phänomen | 173 | ||
| Winterdepression | 174 | ||
| Sekundenschlaf | 175 | ||
| 5.7 Innere Uhr | 175 | ||
| Zirkadiane Rhythmen | 175 | ||
| Rhythmus-Gene | 176 | ||
| Optische Synchronisation | 176 | ||
| Abstimmungen durch Melatonin | 177 | ||
| Schichtarbeit, Jetlag | 177 | ||
| Schlafen | 178 | ||
| REM-Schlafphasen | 179 | ||
| SWS- und REM-Schlaf | 179 | ||
| Schlaf und Gedächtnis | 180 | ||
| Schlafprobleme | 180 | ||
| Melatonin, Blutzucker, Interleukin-1 | 180 | ||
| Schlafstrategien | 181 | ||
| 5.8 Zu Emotionen und Stimmungen halten wir verschiedene Punkte fest: | 182 | ||
| 5.9 Literatur | 183 | ||
| Kapitel 6: Bewegungskoordination | 188 | ||
| 6.1 Starre Körperposen | 188 | ||
| Regelung der Muskellänge | 188 | ||
| Stellungsänderung durch Bereichsverstellung | 188 | ||
| Katalepsie als Verhaltensweise | 189 | ||
| 6.2 Bewegungsrhythmen | 190 | ||
| Zentraler Mustergenerator | 191 | ||
| Hierarchische Koordination | 191 | ||
| Sensorische Kontrolle der Koordination | 192 | ||
| Relative und absolute Koordinationen | 194 | ||
| Demokratische Koordination und periphere Kontrolle beim Schreiten | 195 | ||
| Neuromodulation beim Kauen | 196 | ||
| Algorithmische und implementierende Funktionen | 197 | ||
| 6.3 Das motorische System des Menschen | 198 | ||
| Motorkoordinationen | 198 | ||
| Koordinationsprogramme | 199 | ||
| Unerwartete Funktionen des Kleinhirns: Kognition und Zeitsteuerung des Verhaltens | 200 | ||
| Motorische Bewegungen sich vorstellen | 201 | ||
| Krankheiten des motorischen Systems | 202 | ||
| unschädlich gemachtem Adeno-Virus. Eines der Schreitprogramme für Querschnittsgelähmte | 203 | ||
| 6.4 Zu Motorkoordinationen halten wir verschiedene Punkte fest: | 205 | ||
| 6.5 Literatur | 206 | ||
| Kapitel 7: Lernen und Wissen: Zugang zum Denken | 210 | ||
| 7.1 Angeboren oder erlernt? | 210 | ||
| 7.2 Habituation | 210 | ||
| Reizspezifische Gewöhnung | 210 | ||
| Neurophysiologische Grundlagen | 210 | ||
| 7.3 Sensitisierung | 211 | ||
| Sensibilisierung und Dishabituation | 211 | ||
| Aktivitätsabhängige strukturelle und funktionelle synaptische Plastizität | 211 | ||
| Tetanische Langzeitpotenzierungen LTP | 212 | ||
| Wechselbeziehungen zwischen Struktur und Funktion | 213 | ||
| CREB2/CREB1-Balance: Zutritt zum Gedächtnis | 213 | ||
| 7.4 Assoziatives Lernen | 214 | ||
| Klassische Konditionierung | 214 | ||
| Instrumentelle Konditionierung | 214 | ||
| Assoziatives Lernen bei Meeresschnecken | 215 | ||
| Furchtkonditionierung | 216 | ||
| Assoziationen von Unwichtigkeiten mit großen Ereignissen | 216 | ||
| Lidschlagkonditionierung | 218 | ||
| 7.5 Gedächtnisfunktionen | 219 | ||
| Arbeitsgedächtnis | 219 | ||
| Konsolidierungszeit | 220 | ||
| Informationsauswahl | 221 | ||
| Langzeitgedächtnis | 222 | ||
| Festlegung von Gedächtnisinhalten in Neuronenschaltungen | 222 | ||
| Biochemische Grundlagen | 223 | ||
| Scotophobin, Hypophysenhormone, Neurotransmitter | 223 | ||
| 7.6 Gedächtnissysteme | 224 | ||
| Deklaratives Wissen | 225 | ||
| Speichern und Abrufen von deklarativem Wissen | 225 | ||
| Ortsgedächtnis | 226 | ||
| Prozedurales Wissen | 226 | ||
| Gedächtnis und Aufmerksamkeit | 227 | ||
| 7.7 Denken mit zwei Hirnhälften | 227 | ||
| Lateralität von Hirnfunktionen im Tierreich | 228 | ||
| Arbeitsteilung beider Hemisphären beim Menschen | 228 | ||
| Sensorische Tests | 229 | ||
| Koordinierender Balken | 229 | ||
| Sprechen, Schreiben und Verstehen | 230 | ||
| Sprachareale für Fremdsprachenerwerb | 232 | ||
| Legasthenie | 233 | ||
| Ausfälle in den Spracharealen | 233 | ||
| 7.8 Fragen zur Lateralisation | 234 | ||
| Phylogenetische Aspekte | 234 | ||
| Rechtshänder und Linkshänder | 235 | ||
| Geschlechtsspezifische Unterschiede | 235 | ||
| Funktionelle Hinweise | 236 | ||
| 7.9 Zutritt zum Bewußtsein | 236 | ||
| Aufmerksamkeit und Wahrnehmung | 237 | ||
| Wahrnehmen, Wissen, Sich-Vorstellen | 237 | ||
| Denken und Bewußtsein | 238 | ||
| 7.10 Zum Lernen halten wir verschiedene Punkte fest: | 240 | ||
| 7.11 Literatur | 241 | ||
| Kapitel 8: Künstliche neuronale Netze und künstliche Intelligenz | 246 | ||
| 8.1 Gehirn und Computer im Vergleich | 246 | ||
| Neurobiologie und Neuroinformatik | 246 | ||
| Vom Gehirn zum Neuro-Computer | 246 | ||
| Neuroinformatik | 247 | ||
| 8.2 Wie arbeitet ein künstliches Neuron? | 248 | ||
| Perceptron: Ein einfaches künstliches neuronales Netz | 248 | ||
| UND-Logik eines Automaten | 250 | ||
| Schwellenwerte und Synapsengewichte | 250 | ||
| Das «Exclusiv-ODER»-Problem | 251 | ||
| 8.3 Mehrschichtiges künstliches neuronales Netz | 251 | ||
| Netz-Topologie für eine Fallstudie | 251 | ||
| Vorverarbeitung und Training | 253 | ||
| Netzwerkeigenschaften | 253 | ||
| Neurobiologische Parallelen | 254 | ||
| 8.4 Bionik | 255 | ||
| Künstliche Retina | 255 | ||
| Retina-Implantat | 255 | ||
| Sensorische Substitution | 256 | ||
| Cochlea-Implantat | 256 | ||
| Roboter-Greifhand | 257 | ||
| Arm- und Beinprothesen | 257 | ||
| 8.5 Genetisches Programmieren | 257 | ||
| Genetische Algorithmen | 257 | ||
| Artificial Life | 258 | ||
| 8.6 Perspektiven | 259 | ||
| 8.7 Zur Künstlichen Intelligenz halten wir verschiedene Punkte fest: | 260 | ||
| 8.8 Literatur | 261 | ||
| Ein abschließender Dialog: Naturwissenschaftliches Erkennen und menschliches Erleben | 264 | ||
| Der Mensch deutet seine Welt | 264 | ||
| Das Orientierungsproblem | 267 | ||
| Wissenschaftliche Erklärungen lösen mythische Vorstellungen ab | 269 | ||
| Erkenntnisebenen und Kategorienfehler | 270 | ||
| Hirnforschung und Selbsterfahrung des Geistes | 271 | ||
| Neurobiologische Modelle elementarer Denkprozesse | 273 | ||
| Literatur | 276 | ||
| Anhang | 278 | ||
| Neurophysiologische Funktionselemente | 278 | ||
| Molekulare Grundlagen von Bewegungen | 282 | ||
| Literatur | 284 | ||
| Stichwortverzeichnis | 286 | ||
| Abkürzungen | 302 |







