
Mein Appetit-Lexikon - Eine Warenkunde für Genießer
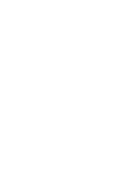
von: Kurt Bracharz
Haymon, 2013
ISBN: 9783709974575
Sprache: Deutsch
352 Seiten, Download: 1746 KB
Format: EPUB
G
Gans
Hurra die Gans!
Einmal im Jahr hat auch bei uns die Gans Saison, seit die Italiener auf die Idee gekommen sind, den Heiligen Martin zum Patron dieser Vögel zu machen (er ist u. a. auch der Schutzheilige der Ausrufer, Bettler, Bürstenbinder, Hoteliers, Panzerhemdenhersteller, Waffenschmiede, Antialkoholiker und der aller katholischen Armeen). Die französischen Gourmets schätzen die Gans eher gering (von der Leber einmal abgesehen), haben ihr aber einen eigenen Heiligen namens Feréol zugeordnet, über den Rabelais schreibt, er habe nichts so sehr geliebt wie fette Gänse und junge Mädchen.
Bei den Gänsen kann der heilige Feréol da nicht viele Probleme gehabt haben: es gibt kein fetteres Geflügel als die Gans (7 % in Brust- und Beinfleisch). Sie wird deshalb vor dem Braten im Ofen von allem sichtbaren Fett befreit, und zunächst nicht sichtbares Fett sollte vom Rost abtropfen können. Angeboten werden in der Praxis Tiefkühlgänse und theoretisch Mast- und freilaufende Gänse, von denen die ersten maximal 7 kg und die zweiten höchstens 4 kg wiegen sollten. Auf keinen Fall dürfen sie älter als ein Jahr sein (Freilaufende acht Monate!). Die Mastgänse sollten mit Hafer gefüttert worden sein. Die Stubengans ist nicht älter als fünf Monate und wiegt maximal 2,5 kg. Fragen Sie nicht mich, wo Sie so einen Braten herkriegen, aber sagen Sie es mir, falls Sie es wissen. Alfred Walterspiel urteilte: „Für die raffinierte Küche kommt nur die Stubengans in Frage. Eine sauber gehaltene und geschickt gefütterte Stubengans wird von vielen Feinschmeckern sogar einer jungen Ente vorgezogen. Da ihre Haut für den Kenner fast wichtiger ist als das darunterliegende Fleisch, muß die Gans knusprig gebraten werden.“
Eine 4–5 kg schwere Gans muss etwa zwei Stunden bei 220 Grad und dann 20 Minuten bei 260 Grad gebraten werden. Viele Füllungen enthalten Äpfel (in Hamburg nimmt man gedünstete Apfelspalten mit Backpflaumen, in Mecklenburg Leber, Rosinen und in Weißwein gedünstete Äpfel, im Norden Kümmel, Zwiebel, Apfelschnitze und Majoran), aber es geht auch mit Äpfeln und Rosinen (in Dänemark) oder mit Bratwurstbrät und Sauerkraut (im Elsaß). Das einzige österreichische Bundesland mit genuinen Ganslrezepten ist das Burgenland, hier füllt man mit Äpfeln und Majoran, dünstet vorgebratene Gansstücke in Sauerkraut mit Weißwein und hat auch ein Rezept für gespickte Gansleber. Im Mühlviertel briet man früher das gestockte Blut der Gans mit Zwiebeln und Majoran.
Bei uns sollte man sich schon überlegen, wo man die Martinigans isst, wenn man sie nicht selbst zubereitet, denn sie kann einem schwer im Magen liegen. Nur wenn sie richtig gebraten ist, gilt jener Spruch des Berliner Schriftstellers Adolf Glasbrenner, von dem böse Zungen behaupten, er sei das Einzige, was vom Werk dieses Literaten Bestand hat: „Eene jut jebratene Jans is ne jute Jabe Jottes.“ Der Wein trägt dazu bei: Zum Fleisch passt ein kräftiger Rotwein, zur Brust auch ein junger Weißer – falls es Sauerkraut gibt, ein elsässischer Pinot Gris.
[9.11.1995]
Vom Gänseklein
Gegen einen klassischen Gänsebraten ist absolut nichts einzuwenden; außer vielleicht, dass man sich manchmal fragt, ob es nicht auch noch andere Zubereitungsmöglichkeiten gibt und wie man dem Gansviertel mit einem normalen Gasthausbesteck zu Leibe rücken kann, ohne das Rotkraut auf dem Tischtuch zu verteilen, wenn man mit dem Messer zum dritten Mal an der kross gebratenen, von Natur aus schon sehr dicken Ganslhaut abgerutscht ist. Eine mögliche Antwort auf beide Fragen heißt Gänseklein und ist aus neueren Kochbüchern ebenso wie von den meisten Speisekarten völlig verschwunden. Ist dieses Ragout nicht mehr fein genug für den zeitgenössischen Genießer, der sich stets zwischen Brust, Keule und Leber entscheiden muss?
Das Rezept ist schon alt. So heißt es etwa im „Bernerischen Koch-Büchlein“ von 1749 „Gänsen-Ragout zu machen: Nimme von einer Ganß so du braten wilt, den Hals, die Flügel, die Füsse, Lebern und Magen, wäsche alles sauber, thue es in einen Hafen, Wasser daran bis darob zusammen geht; lasse es halb einkochen, thue dann daran aller Gattung Pulver und Salz, ein Handvoll gewäschene Rosinlein, ein Glas voll Wein, röste eine Handvoll Brotbröcklein schön gelb, thue alles zusammen, laß es einkochen, so wird es gut seyn.“
Mittlerweile ist man etwas pingeliger geworden und empfiehlt kaum mehr, „aller Gattung Pulver“ an die Speisen zu tun. In Louise Büchis „Heinrichsbader Kochbuch“ liest man unter Nr. 682 folgende Anleitung: „Gänseklein oder Ganspfeffer. Civet d’oie à la Bourgeoise. Die Füße und der Schnabel werden in kochendem Wasser gebrüht bis man sie schälen kann, dann geschält. Kopf, Magen, Herz und Flügel werden sauber geputzt. In Butter wird ein Kochlöffel Mehl gelb geröstet, das Fleisch dazugegeben, ein wenig damit geröstet, etwas Fleischbrühe, ein Glas Wein, Salz, Pfeffer und Muskatnuß dazu und etwa 1 ½ Stunden gekocht. Es kann mit bayrischen oder Semmelklößchen serviert werden.“ Andere Autorinnen der ersten Jahrhunderthälfte präzisieren noch, dass man von den Füßen die Krallen und vom Kopf die Augen entfernt, und das „Neue Stuttgarter Kochbuch“ fügt kurz vor dem Auftragen noch mit Essig verrührtes Gänseblut hinzu, das freilich schon beim Schlachten aufgefangen worden sein sollte. Das tut auch noch Franz Ruhm in seinem 1940 erschienenen „Kochen im Krieg“, der „zur Ergänzung ein Stück minderes Gansfleisch“ als Zutat vorschlägt. Heute darf es schon ein Stück vom besseren sein. Heinrich Hoffmann, der Verfasser des „Struwwelpeter“, kochte mageres Schweinefleisch im Gänseklein mit und schmeckte mit einem Schuss Madeira ab.
Ein deutscher „Speiseführer“ von 1850 urteilte: „Gekocht sind Gänse abscheulich, geräuchert besser als gebraten. Sauer eingekochte Gänse sind zwar nicht ohne Verdienst, doch gibt es nur ein Gericht, das ein Gourmand immer wieder essen mag. Dieses treffliche Gericht ist ein Frikassee von Gänsezungen, das die Pommerschen Edelleute, welche Gänse in Massen aufziehen und räuchern lassen, hoch schätzen.“
[11.11.1999]
Tipps zum Gänsebraten
Gänse kommen heute meist tiefgekühlt in den Haushalt, es empfiehlt sich also, zunächst einmal darauf zu achten, dass die Packungen keinen Reifansatz aufweisen, die Gans keine weißen, trockenen Flecken (Gefrierbrand) hat und dass sie beim Transport nicht antaut. Aufgetaut wird sie am besten im Kühlschrank, wozu eine vier Kilogramm schwere Gans immerhin 36 bis 40 Stunden braucht. Hat der Vogel im Kühlschrank keinen Platz, geht es halt nur etwas weniger hygienisch auf einer umgedrehten Platte, von der die austretende Flüssigkeit leicht abfließen kann (oder besser auf einem Gitter). Gänseteile können, in Alufolie eingewickelt, in der Mikrowelle angetaut werden, sollten danach aber auch konventionell aufgetaut werden. Kauft man frische Gänse, kann man auf die traditionellen Frischekennzeichen achten: spitze, noch weiche Nägel, biegsamer Schnabel, zarte, einreißbare Schwimmhäute. Die klassische Martinigans wird mit Beifuß und Majoran gewürzt, für andere Zubereitungen kommen auch Bohnenkraut, Estragon, Ysop oder Thymian in Frage. Die mit Salz, Pfeffer und den Gewürzen eingeriebene Gans lässt man eine Stunde ruhen, während man eine Füllung (zum Beispiel aus Kastanien, Brot, Champignons und Schalotten) zubereitet. Die Gans wird auf eine der Keulen in eine mit etwas Wasser gefüllte Kasserolle gelegt und im vorgeheizten Backofen unter häufigem Wenden und Begießen geraume Zeit (je nach Größe, aber mindestens gute zwei Stunden) geschmort und gebraten. Vor dem Aufschneiden sollte sie wie jedes größere Geflügel unbedingt eine Viertelstunde ruhen, am besten auf einem Abtropfgitter. Das reichlich ausgetretene Gänseschmalz kann in der Küche vielfältig verwendet werden, etwa als Bratfett für Rotkraut oder mit Beifuß und Äpfeln als Brotaufstrich.
Zum Tranchieren der Gans sei als Kuriosität eine Anleitung aus dem Jahre 1792 in der Originalorthografie zitiert: „Gans. Man steckt solche mit dem Steiß gegen sich, legt die Gabel auf die Brust, schneidet die Haut am Steiß mit einem Kreuzschnitt auf, hängt das Messer zu Gabel, nimmt die Fülle auf einen Teller heraus, wenn es Äpfel oder Kastanien sind, ist es aber Bohnenkraut, so lässt man es darinn, dreht nun die Schüssel, so daß der Hals zur rechten Hand kommt, hernach sticht man die Gabel wie bei’m gebratenen Huhn hinein, ohne daß sie wegen Sperrung der Beine für sich aufgehoben wird. Die Zerlegung geschieht nun also: 1) Schneidet man den Hals ab, 2) den rechten Flügel nebst dem Pfaffenschnitt wie bei’m welschen Hahn, wenn anders die Gans fett ist; 3) den rechten Schenkel, 4)...








