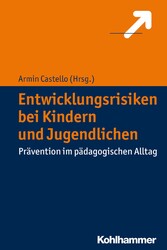
Entwicklungsrisiken bei Kindern und Jugendlichen - Prävention im pädagogischen Alltag
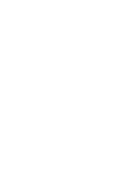
von: Armin Castello
Kohlhammer Verlag, 2014
ISBN: 9783170240810
Sprache: Deutsch
180 Seiten, Download: 3802 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Entwicklungsrisiken bei Kindern und Jugendlichen - Prävention im pädagogischen Alltag
Schutz des Kindeswohls
Armin Castello und Torsten Schutzbach
Fallbeispiel
Lea (6) ist kürzlich in eine andere Stadt umgezogen und daher erst seit wenigen Wochen in ihrer neuen Kita. Sie soll aber bereits im Sommer eingeschult werden. Das erste Gespräch der Kita-Leitung mit Leas Eltern war leider nur sehr kurz, da beide angeben, mit den neuen Arbeitsstellen, die sie nun hätten, zeitlich sehr eingeschränkt zu sein. Lea kommt seither morgens und geht nachmittags alleine nach Hause.
In der Vorschulgruppe kümmert sich die Erzieherin Frau Hirt neuerdings um Lea. Es werden dort verschiedene Programme zur Vorbereitung der Einschulung durchgeführt. Frau Hirt fällt auf, dass Lea immer noch keinen Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt und dass sie in den Übungen, bei denen die meisten Kinder eifrig ans Werk gehen, eher teilnahmslos wirkt. Lea nimmt in den Essenszeiten kaum etwas zu sich, wobei Frau Hirt dabei das lieblos mitgegebene Essen bemerkt. Das Mädchen klagt öfter über Müdigkeit und Bauchschmerzen, sitzt tagsüber lange Phasen einfach nur auf einem Stuhl und meidet den Kontakt zu allen, auch zu Erwachsenen.
Nachdem Lea neulich wieder über Bauchschmerzen klagte, soll sie sich im Ruheraum etwas hinlegen und wird von Frau Hirt begleitet. Als Lea den obersten Knopf ihrer viel zu engen Hose öffnet, sieht Frau Hirt zahlreiche Blutergüsse und große, teils schlecht versorgte Schürfwunden am Bauch des Kindes. Die Erzieherin ist schockiert und fragt Lea, wie denn das passiert sei. Lea antwortet nicht und wendet den Kopf ab. Frau Hirt ist verunsichert und weiß nun nicht, wie sie handeln soll.
1 Ebenen möglicher Kindeswohlgefährdungen
Artikel 19 der von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten UN-Kinderrechtskonvention (Bundesgesetzblatt, 1992) führt verschiedene Ebenen möglicher Kindeswohlgefährdungen auf:
• Vernachlässigung der Grundversorgung, d. h. keine angemessene Ernährung, Kleidung, Hygiene, Gesundheitsversorgung oder Wohnung; Fehlen eines adäquaten Schutzes vor Gefahren, mangelnde oder keine Befriedigung des natürlichen Bindungsbedürfnisses eines Kindes, inadäquate Betreuung und keine altersangemessene Anregung
• Seelische Misshandlung, d. h. Unterlassungen (z. B. Ignorieren, Isolieren) oder aktive Handlungen (Beschimpfen, Verspotten, Bedrohen), die die seelische Entwicklung beeinträchtigen (Deegener, 2005, 38)
• Körperliche Misshandlung wie z. B. Schlagen, Schütteln, Verbrennen
• Sexuelle Misshandlung, d. h. sexuelle Handlungen, die an, mit oder vor einem Kind durchgeführt werden
Das Kindeswohl kann zudem in Familien gefährdet sein, die sich in Krisensituationen befinden. Hierzu gehören massive Konflikte, wie sie teilweise in Trennungsphasen auftreten, Gewalt zwischen Familienmitgliedern oder eine körperliche und/oder seelische Erkrankung der Eltern (Maywald, 2010). Ebenso kann eine Suchterkrankung der Eltern bzw. von nahen Bezugspersonen als Gefährdung des Kindeswohls wirksam werden.
Jenseits dieser Ebenen werden Kindeswohlgefährdungen unterschieden, abhängig vom Schweregrad und der zeitlichen Ausdehnung bzw. Häufigkeit, in der eine Misshandlung oder Vernachlässigung stattfindet. Ebenso spielt in der Bewertung der Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen dessen Alter eine bedeutsame Rolle.
2 Häufigkeiten
Körperliche Misshandlung erfahren, so die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (AWMF, 2008) 11,8 % der männlichen und 9,9 % der weiblichen Kinder und Jugendlichen. In einer länger zurückliegenden, aber repräsentativen Untersuchung (Pfeiffer et al., 1999) wurden Kinder und Jugendliche nach Gewalterfahrungen durch Eltern befragt, unterschieden nach deren Ausmaß und Häufigkeit.
Tab. 1: Häufigkeiten körperlicher Züchtigung (u. a. schlagen, anpacken, »eine runterhauen« und Misshandlungen, zusammenschlagen, treten, würgen und Waffeneinsatz) (vgl. Deegener, 2005, 40)
Häufige Misshandlung tritt bei Kindern in dieser Untersuchung deutlich stärker auf als bei Jugendlichen, jedes 20. Kind scheint betroffen zu sein. Ebenso ist der Anteil weder »Gezüchtigter« noch »Misshandelter« im Jugendalter geringer. Besonders gefährdet sind offenbar sehr kleine Kinder (Lengning & Zimmermann, 2009), insbesondere in Risikokonstellationen (s. u.). Verschiedene Untersuchungen weisen inzwischen aber darauf hin, dass sich, insbesondere mit Bezug zur körperlichen Misshandlung, ein Rückgang abzeichnet.
Von sexuellen Misshandlungen mit Körperkontakt im Kindes- und Jugendalter berichteten 1992 2,8 % der männlichen und 8,6 % der weiblichen Befragten (Wetzels, 1997). Deegener (2005, 48) schätzt die Prävalenz von sexuellen Misshandlungserfahrungen bei Mädchen noch mit 10–15 % und der Jungen mit 5–10 %. In einer neueren repräsentativen Untersuchung zeichnet sich auch ein Rückgang der sexuellen Misshandlungen insgesamt ab, die bei weiblichen Befragten bei 6,4 % und bei männlichen bei 1,3 % (Bieneck, Stadler & Pfeiffer, 2011) liegen. Als mögliche Ursachen dieser erfreulichen Entwicklung benennen die Autoren die veränderte Anzeigebereitschaft, eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit und Informiertheit durch Präventionskampagnen und den Umstand, dass durch den tendenziellen Rückgang von Misshandlungen und Vernachlässigungen weniger gefährdet sind (s. u.).
Der Deutsche Kinderschutzbund (2006, 12) beklagt, dass in der Bundesrepublik, als eine der wenigen Industrienationen, keine Statistik zur Häufigkeit von Kindesvernachlässigung existiert. Dennoch scheint diese Form der Kindeswohlgefährdung besonders verbreitet zu sein. Deegener (2001) schätzt auf der Grundlage von US-amerikanischen Zahlen etwa, dass Fälle der Kindeswohlgefährdung in ca. 40–50 % mit Vernachlässigungen, 25 % körperlicher Gewalt, 10 % sexueller Misshandlung, 3 % mit seelischer Misshandlung und etwa 15 % mit sonstigen Gefährdungen beschrieben werden können. Eine Befragung von Ärzten (Heintze et al., 2006) ergab, dass 12,9 % der bei Kinderärzten und 3,7 % der bei Hausärzten vorstelligen Kinder als vernachlässigt identifiziert wurden.
3 Risiko- und Schutzfaktoren
Bender und Lösel (2006) beschreiben Risiko- und Schutzfaktoren, die die Misshandlung von Kindern und Jugendlichen begünstigen. Das Risiko steigt demnach, je jünger die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt ist, je mehr Kinder in der Familie leben und je geringer der Bildungsgrad in der Familie ist. Als Risikofaktoren gelten auch internalisierende psychische Störungen wie z. B. Ängste und Depressionen der Eltern. Besondere Persönlichkeitsmerkmale, die sich in erhöhter Erregbarkeit, geringerer Impulskontrolle und reduzierter Frustrationstoleranz zeigen, scheinen gleichfalls das Risiko von Misshandlungen zu steigern, wie auch bestimmte irrationale pädagogische Überzeugungen (z. B.: »Das Baby will mich ärgern«, oder: »Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet«). Haben Eltern altersunangemessene oder unrealistische Erwartungen an die Möglichkeiten eines Kindes, das eigene Verhalten zu steuern, kann dies zur Enttäuschung und Verärgerung führen, was das Risiko von Misshandlungen verstärkt. Langfristig kann sich ein negatives Erziehungsselbstkonzept entwickeln, das durch empfundene Ohnmacht, Enttäuschung und Wut gekennzeichnet ist.
Auch eigene Gewalterfahrungen stellen ein Risiko dar. Ehemals misshandelte Kinder geben vielfach das Modell der erlebten Eltern-Kind-Beziehung weiter. Verstärkend wirkt, dass sie oft in ähnlich belasteten Verhältnissen wie ihre eigenen Eltern leben und ihr Erziehungshandeln ebenso durch ein ungünstiges Temperament (z. B. mit Wutausbrüchen und Kontrollverlust) geprägt sein kann. Als Schutzfaktoren, die die Weitergabe von Misshandlungserfahrungen reduzieren helfen, wirken eine als positiv erlebte Paarbeziehung und die Verarbeitung der erlebten Gewalterfahrung.
Auf Kindseite sind es besonders Regulationsprobleme (Essen, Schlafen, Verhalten), die das Risiko von Misshandlungen erhöhen. Sie können wiederum ursächlich verbunden sein mit Auffälligkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion, wodurch ein sich stabilisierender Teufelskreis aus Misshandlung und Regulationsschwierigkeiten entstehen kann.
In einer Broschüre des...








