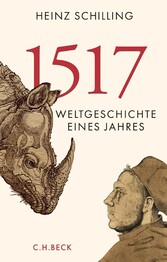
1517 - Weltgeschichte eines Jahres
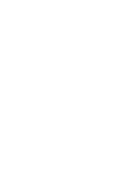
von: Heinz Schilling
Verlag C.H.Beck, 2017
ISBN: 9783406700705
Sprache: Deutsch
366 Seiten, Download: 9313 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
1517 – EIN NEUER BLICK AUF DAS EPOCHENJAHR
1517 war und ist für die protestantische Geschichtsdeutung das annus mirabilis, das von Gott gewiesene Wunderjahr, Beginn einer Zeitenwende. Noch nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges stand für Adolf von Harnack (1851–1930), den wohl bedeutendsten Theologen und Wissenschaftsorganisator seiner Zeit, unverrückbar fest: «Die Neuzeit hat mit der Reformation Luthers ihren Anfang genommen, und zwar am 31. Oktober 1517; die Hammerschläge an der Tür der Schloßkirche zu Wittenberg haben sie eingeleitet.»[1]
2017 indes, im Moment des 500jährigen Reformations-Gedächtnisses in Deutschland und Europa, erscheint das Jahr 1517 in einem anderen Licht. Nicht nur, weil der Mythos des hammerschwingend die Neuzeit eröffnenden Reformators zerbrochen ist. Die Grundlagen unseres Geschichtsbildes haben sich radikal verändert: Der Anfang des 20. Jahrhunderts noch prägende konfessionelle Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus ist in den Hintergrund getreten, ebenso die europazentrische Geschichts- und Epochenbetrachtung. Gewachsen ist dagegen das welt- oder globalgeschichtliche Bewusstsein, das nicht mehr dem «Imperialismus des Universellen»[2] verhaftet ist. An die Stelle des europäischen Neuzeit-Monopols tritt zunehmend die Erkenntnis, dass auch in anderen Teilen der Welt Impulse zum Aufstieg neuer, neuzeitlicher Lebensbedingungen gesetzt wurden.
Damit steht auch die These von der einmaligen universalgeschichtlichen Modernisierungswirkung der im Ablassprotest 1517 geborenen Reformation in Zweifel, die mit der Aufklärung in das allgemeine Geschichtsbild des «Westens» eingegangen ist. In diesem Buch soll das «Epochenjahr 1517» in einem weiten, «globalen» Verständnis von Weltgeschichte neu vermessen werden. Dabei ist die Lupe der Wittenberger Feldforschung zu ergänzen durch das Fernrohr, das die welthistorischen Entscheidungen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit auch anderwärts in Europa und der weiteren Welt erkennen lässt. Eine Globalgeschichte, wie sie für das 19. und 20. Jahrhundert, im Ansatz auch bereits für das Jahr 1688[3], erarbeitet wurde, wird aber nicht angestrebt – zu isoliert standen sich 1517 noch die Weltregionen, ihre Völker und Kulturen gegenüber. Mit dem Mitte des 15. Jahrhunderts einsetzenden Ausgreifen Europas auf neu entdeckte wie altbekannte Kontinente entwickelte sich zwar ein den Globus überspannendes Netz der Kommunikation und des Austauschs. Der rasche Informationsaustausch späterer Jahrhunderte war aber noch ebenso unbekannt wie die uns heute selbstverständliche Eine-Welt-Vorstellung.
Es geht zunächst um einen Bericht über das, was 1517 und in den vorangehenden oder folgenden Jahren, geschah; über die Akteure, ihr Denken und ihre Weltbilder; über die Beweggründe und Folgen ihres Handelns; über die Weichen, die sie für kurze oder langanhaltende Veränderungen stellten. Dabei werden wir mit Welten konfrontiert, die uns heute tief fremd sind. Selbst das uns scheinbar vertraute Europa wird von modernen Sozialhistorikern zu Recht als eine «world we have lost» charakterisiert.[4] Das Fremde beginnt bereits bei der Chronologie. Wer heute von 1517 spricht, geht umstandslos davon aus, dass dieses Jahr am 1. Januar begann und am 31. Dezember endete. Auch die Historiker verfahren in ihren Darstellungen so, müssen dabei aber nicht selten die Zeitangaben ihrer Quellen umrechnen. Denn in der historischen Realität war die Chronologie über die Jahrhunderte hin so bunt und verschiedenartig wie die Völker, Religionen und Kulturen.[5] Und so variieren auch der Anfang und das Ende des Jahres 1517 nicht unerheblich.
Dass über die Kontinente und Zivilisationen die Einteilung und Zählung der Jahre unterschiedlich waren, die Chinesen anders als die Europäer, Inder oder amerikanischen Hochkulturen, die Christen anders als Juden oder Muslime rechneten, wird niemanden überraschen. Ebenso wenig die teilweise bis heute abweichende eigene Chronologie der orientalischen Christen – bei den Kopten etwa war der 11. September Jahresbeginn – oder der orthodox-christlichen Länder, die ihre Jahreszählung aus Ostrom beziehungsweise Byzanz übernahmen und ein neues Jahr am 1. September beginnen ließ. Doch auch dort, wo der Papst Kirchenoberhaupt war, bedeutete das Jahr 1517 für die Zeitgenossen einen recht unterschiedlichen Zeitraum. Zwar hatten bereits die Römer ein gutes Jahrhundert vor Christi Geburt den Jahresbeginn vom bis dahin üblichen 1. März auf den 1. Januar verlegt, den Tag, an dem die Konsuln ihr Amt antraten. Für diese Angleichung der Jahreszählung an das Verfassungsleben hatten sie in Kauf genommen, dass die Zählung der Monatsnamen nicht mehr stimmte, zum Beispiel der September nicht mehr der siebte, sondern der neunte Monat war. Ganz verloren ging der altrömische Jahresbeginn im lateinischen Europa aber nicht. So begann in Venedig das Jahr 1517 am 1. März, was offensichtlich den ökonomischen Interessen der Handelsrepublik keinen Abbruch tat. Am 25. März, dem Fest Mariä Verkündigung, begann das Jahr in Florenz und Pisa, in Schottland und England, nach lokalen Traditionen dort aber auch bereits ein Vierteljahr früher am 25. Dezember, dem Weihnachtstag.
Zudem sollten mit der Thesenveröffentlichung Ende Oktober 1517 die Weichen für eine neue Differenzierung der Jahresberechnung im lateinischen Europa gestellt werden: Die gregorianische Kalenderreform des Jahres 1582, die wegen der Ungenauigkeit des bis dahin gültigen julianischen Kalenders 10 Tage übersprang (vom 4. auf den 15. Oktober), sollten die Protestanten ablehnen, weil sie «päpstlich» war. So wurde die Zeit konfessionell, und die protestantische Welt hinkte 10 Tage hinterher, in Deutschland bis 1700, in Schweden sogar bis 1753.
Wie die Zeit, so waren auch andere Grundbedingungen des menschlichen Lebens ganz anders geprägt als heute, in Europa wie auf anderen Kontinenten: Das Leben der Menschen, des Einzelnen wie der Gesellschaft, war in den engen wie strengen Rahmen der Natur eingespannt. Vom Wetter hingen Ernten und Lebensmittelpreise ab, dadurch gute oder schlechte Ernährung, Gesundheitsrisiken und Ab- oder Zunahme der Sterblichkeitsziffern und damit Bevölkerungsschwund oder Bevölkerungswachstum, was wiederum die Lebenschancen ganzer Generationen beeinflusste. Von diesen Naturzyklen bedingt, teils aber auch unabhängig davon, lauerte die Gefahr unbeherrschbarer, klein- oder großräumiger Epidemien, unter denen die großen transkontinentalen Pestzüge des 14. Jahrhunderts nur die verheerendsten waren, die über Generationen hinweg die Menschen in Europa traumatisierten. Da man die uns heute selbstverständlichen naturwissenschaftlichen Methoden nicht kannte, suchte man – und keineswegs nur die große Masse der Illiterati, der Ungebildeten – Grund oder Sinn solcher Gefahren in einer transnaturalen Interpretation der Welt.
Stellen wir uns das Naturgeschehen für das Jahr 1517 in Europa vor Augen: Das Wetter haben die Menschen seit eh und je sorgfältig beobachtet, und seit Beginn der Schriftlichkeit haben sie darüber Notizen hinterlassen. In Europa stieg dieser Registrierungseifer während des späten Mittelalters sprunghaft an, so dass für 1517 eine Vielzahl von Wetterbeobachtungen vorliegt – aus Klöstern, in systematisch geführten Wetterjournalen, in Kalendarien oder Messtabellen, vereinzelt auch von Privatleuten in Stadt und Land. Danach entsprach das Wetter im Süden Mitteleuropas dem in dieser Phase der europäischen Wettergeschichte Üblichen: Nach zwei milden Wintern 1515 und 1516 wurde der Winter nun streng, so dass es wieder einmal – wie bereits 1514, danach aber erst wieder 1551 – zum Seegfrörne kam, dem vollständigen und länger stabilen Zufrieren der großen oberdeutschen und Schweizer Seen, namentlich des Bodensees, das von den Zeitgenossen stets aufmerksam, ja ehrfurchtsvoll festgestellt und über die Lande hin als Neuigkeit verbreitet wurde. Da zudem viel Schnee fiel, die Böden somit Feuchtigkeit speichern konnten, in den meisten Regionen Mitteleuropas bereits Ende März der Frühling ausbrach und Anfang April ungewöhnlich sommerliche Temperaturen herrschten, waren die Bedingungen für das Aufwachsen der Saat sehr gut.
Man konnte also eine reiche Ernte und somit stabile Nahrungsmittelpreise und eine gute Ernährungslage für die gesamte Bevölkerung erwarten. Indes, diese Prognosen erfüllten sich nicht durchgehend. Im weiteren Jahresverlauf schlug das Wetter wiederholt abrupt um. Zunächst blieb der Regen aus, so dass eines der trockensten Frühjahre des Jahrhunderts verzeichnet wurde und die Wasserknappheit die gut entwickelten jungen Pflanzen zu ...









