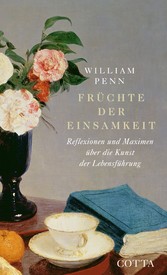
Früchte der Einsamkeit - Reflexionen und Maximen über die Kunst der Lebensführung
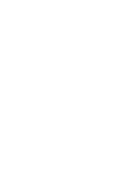
von: William Penn, Jürgen Overhoff
Klett-Cotta, 2018
ISBN: 9783768199162
Sprache: Deutsch
313 Seiten, Download: 3352 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
William Penn,
der weltkluge Visionär
»Der erlauchte William Penn« und
seine Meditationen über das Leben
Es gab einmal eine Zeit, in der sich die größten Geister an ihm und seinem Wirken ausrichteten, an William Penn (1644–1718), dem streitbaren Pazifisten und eleganten englischen Gentleman, dem Großgrundbesitzer, der in Amerika die Kolonie Pennsylvania mit der Hauptstadt Philadelphia (zu Deutsch: ›Bruderliebe‹) gründete, um dort seinen Glaubensbrüdern, den unterdrückten Quäkern, und allen anderen wegen ihrer Religion verfolgten Menschen ein Asyl des Friedens zu gewähren. Die erste wichtige Würdigung seines Lebenswerkes erschien schon bald nach seinem Tod, als sich Voltaire, der geniale französische Dichter und Aufklärer, in seinen 1734 veröffentlichten Lettres philosophiques tief und ehrlich vor ihm verneigte. Im vierten Kapitel dieser philosophischen Abhandlung, das dem bemerkenswerten Engländer ganz gewidmet war, nannte der Franzose ihn voller Respekt »l’illustre Guillaume Penn«. Übersetzen lässt sich diese huldreiche Wendung mit den Worten: »Der erlauchte William Penn«.
Illuster, von einem milden Glanz durchleuchtet, erschien Penn dem Franzosen deshalb, weil er über eine ganz seltene Noblesse des Charakters und der Lebensführung verfügte, weshalb er sogar auf diejenigen anziehend wirkte, die seine religiösen Ansichten nicht teilten. Schon als junger Mann hatte er sich den Quäkern angeschlossen, einer Sekte aus dem Spektrum des radikal-egalitären Protestantismus, deren Angehörige sich selbst auch schlicht als »Freunde« bezeichneten. Weil sie den Kriegsdienst verweigerten und keine Eide schwören mochten, wurden ihre wichtigsten Anführer drangsaliert und inhaftiert, so auch Penn. Voltaire machte keinen Hehl daraus, wie sehr er die Bereitschaft dieses Mannes bewunderte, »für seine Sache zu leiden«. Sogar der englische König Charles II. Stuart bezeugte Penn Sympathien. Unmittelbar nach dem Ableben von Penns Vater, bei dem der leichtlebige Monarch hoch verschuldet war, beschenkte Seine Majestät den rechtmäßigen Erben des Verstorbenen zum Ausgleich mit Ländereien aus dem Besitz der Krone in Amerika, wo der überraschte Empfänger dieser Wohltat alsbald seine eigene Kolonie errichtete.
Voltaire zeigte sich von Pennsylvania und seiner »so sehr blühenden« Metropole Philadelphia hingerissen, denn dort werde, anders als in den alten Königreichen Europas, »niemand wegen seiner Religion malträtiert«. Jeder pennsylvanische Siedler genieße ohne Ausnahme eine uneingeschränkte »Freiheit des Gewissens«. Zudem hätten althergebrachte Standesunterschiede für die Bewohner des neuen amerikanischen Gemeinwesens keine Bedeutung mehr; alle akzeptierten sich gegenseitig als »gleiche Bürger«, die außerdem gelernt hätten, sich »als Brüder zu betrachten«. Möglich geworden sei dieser Lebensstil allein durch das Wirken Penns, der seiner Kolonie »sehr weise Gesetze gegeben« habe. Voltaires Eloge gipfelte dann in einem kaum zu überbietenden Lobpreis: »William Penn kann sich rühmen, das vielbesungene Goldene Zeitalter auf die Erde geholt zu haben, das wahrscheinlich niemals existiert hat, außer in Pennsylvania.« Penns Staat war für Voltaire eine Musterprovinz der angewandten Aufklärung.
Goethe, der deutsche Dichterfürst, stieß ins selbe Horn. Schon als junger Mann zeigte er sich von Pennsylvania sehr angetan, als er unter dem Einfluss der Frankfurter Pietisten um Susanne von Klettenberg stand, die regen Kontakt zu Penns Land der religiösen Freiheiten unterhielten. Kurz vor seinem Umzug nach Weimar wäre er dann sogar um ein Haar mit seiner großen Liebe Lili Schönemann nach Amerika ausgewandert, so jedenfalls bekannte er es später in seinen Memoiren. Noch im hohen Alter fragte er sich, welchen Verlauf sein Leben dann wohl genommen hätte. Die Faszination für Amerika ließ ihn zeitlebens nicht los. Davon zeugt nicht nur sein 1827 veröffentlichtes Gedicht Den Vereinigten Staaten, das mit dem Vers »Amerika, du hast es besser« einsetzt. Zwei Jahre später vollendete er seinen Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre, in dessen siebenten Kapitel er seine große Verehrung für den Gründer der amerikanischen Provinz Pennsylvania zum Ausdruck brachte. Vom »erhabenen William Penn« ist da die Rede. Hervor hob Goethe vor allem das »hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Tätigkeit eines so vorzüglichen Mannes«. Dabei erinnerte er auch an »den Konflikt«, in den Penn »mit der Welt geriet«, redete von »den Gefahren und Bedrängnissen, unter denen der Edle zu erliegen schien«, die er letztlich aber in bewunderungswürdiger Weise meisterte.
Goethe wusste auch, dass zu Penns zahlreichen Bedrückungen eine lange, insgesamt drei Jahre währende Zeit der zwangsverordneten Zurückgezogenheit zählte. Denn zwischen 1690 und 1692 konnte der vorübergehend wieder aus Philadelphia nach England zurückgekehrte Penn sein Londoner Domizil an der Themse kaum einmal unbehelligt verlassen. Der seit 1689 amtierende neue englische König William III., ein Oranier, hielt ihn für einen gefährlichen Parteigänger des gerade erst abgesetzten katholischen Monarchen James II. und ordnete deshalb seine permanente Überwachung an. In dieser schwierigen Lebensphase, in der sein Bewegungsradius so sehr eingeschränkt war, dass er faktisch unter Hausarrest stand, nutzte Penn die unfreiwilligen Stunden der Muße dazu, die Ergebnisse all seiner Erfahrungen und Betrachtungen, seines Denkens und bisherigen Tuns in knappen, aphoristischen Wendungen festzuhalten. Als der König dann seinen Zugriff lockerte, weil er einsah, dass er Penn zu Unrecht verdächtigt hatte, veröffentlichte dieser seine gesammelten Aufzeichnungen im Jahr 1693 unter dem bescheidenen Titel Some Fruits of Solitude und wies sie im Untertitel als persönliche Zusammenstellung von diversen »Reflexionen und Maximen« aus. Goethes eigene Kollektion von Sprüchen, Aperçus und Pointen, die er bis ins hohe Alter ständig erweiterte und die erst postum, im Jahr 1833, von Johann Peter Eckermann und Friedrich Wilhelm Riemer in der Cotta’schen Buchhandlung unter der Überschrift Einzelheiten, Maximen und Reflexionen herausgegeben wurde, erinnert in vielerlei Hinsicht an Penns Vorbild. Viele Sentenzen Goethes, wie zum Beispiel die Ziffern 78 und 709, preisen denn auch die von Penn begründete amerikanische Toleranz in Religionsangelegenheiten.
Penns von Voltaire so bewunderte Toleranzpolitik und seine von Goethe nicht minder geschätzte Herzensbildung und Menschenkenntnis, die aus einem tiefempfundenen Gerechtigkeitsstreben und einer großen Leidensfähigkeit erwuchsen, blieben vom Zeitalter der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert für Europäer und Amerikaner gleichermaßen bedeutungsvoll und verehrungswürdig. Seine Reflexionen und Maximen fanden immer wieder begeisterte Leser, sie galten lange als kostbarer Schatz einer unvergänglichen Weisheitsliteratur. Auch in deutscher Übersetzung erschienen sie. Johann Friedrich Schiller, ein Cousin des Dichters, veröffentlichte Penns Gedanken im Jahr 1785 in der Diktion der damaligen Zeit in Goethes späterem Hausverlag Cotta in Tübingen unter dem Titel Früchte der Einsamkeit, in Gedanken und Maximen über den menschlichen Lebenswandel. Die bislang letzte, leider etwas zu bieder geratene deutsche Übertragung, die 1913 am Vorabend des Ersten Weltkriegs im Heidelberger Universitätsverlag Winter erschien, besorgte Siegfried Graf von Dönhoff. Gelesen wurde dieses Büchlein hierzulande noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als das American Friends Service Committee, eine caritative Quäkerorganisation, die 1947 den Friedensnobelpreis erhielt, dem ehemaligen Kriegsgegner humanitäre Hilfe durch Kinderspeisungen leistete und damit auch in beeindruckender Weise für die eigenen Überzeugungen warb. Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer zunehmend erfolgreichen Einbindung in internationale Friedensorganisationen wie die UN oder die EU rückte das Interesse am Friedensapostel Penn dann mehr und mehr in den Hintergrund, als habe er seine Mission zur Genüge erfüllt.
Im Jahr 2007 hätte man allerdings durchaus wieder auf Penn und seine eindringlichen Meditationen über das Leben aufmerksam werden können, denn da erschien auch in Deutschland in einer Rekordauflage der letzte Band der von unzähligen Enthusiasten gefeierten Harry-Potter-Saga, dem die Autorin Joanne K. Rowling als resümierendes Motto einige Sätze aus Penns Some Fruits of Solitude voranstellte. Die von Rowling ausgewählten Maximen handeln von eben jenen Themen, die in ihren Büchern das immer wiederkehrende Leitmotiv darstellen: Beständige Freundschaft und Trost auch im...









