
TEXT + KRITIK 231 - Thomas Meinecke
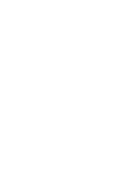
von: Charlotte Jaekel
edition text + kritik, 2021
ISBN: 9783967075427
Sprache: Deutsch
105 Seiten, Download: 4081 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Charis Goer / Thomas Meinecke
Feministischer Materialismus, Adornos Widersprüche, mediokre Körperteile, digitale Glitches, kollaborative Briefromane: »Da gibt es noch so viel zu entdecken«
Ein Gespräch
Charis Goer: Erzähl doch erst einmal, was dich im Moment so interessiert.
Thomas Meinecke: Neu dazugekommen, könnte man sagen, ist in der letzten Zeit einmal der ganze Komplex Materialismus, also die Wiederkehr – für mich ist es eine Art Wiederkehr, für andere ein Nie-Weggewesensein – von materialistischen Zusammenhängen. Und ich habe immer noch nicht begriffen, ob das ganz verschiedene Interessen sind, die damit verbunden sind: nämlich einmal im klassisch marxistischen Sinne Materialismus, im anderen Sinne – und vielleicht ist das eben gar nicht ein so anderer Sinn – aber auch der, der eher ins Latour-hafte spielt: »Das Parlament der Dinge«. Wo ich aber dann etwas enttäuscht war, nachdem ich dort gelesen hatte, dass es da Dinge im Sinne von Angelegenheiten sind, also gar nicht mal unbedingt der Gegenstand im haptischen, physischen Sinne. Ich weiß nicht genau, worauf damit abgezielt wird, weil es für mich im Moment noch nicht ganz trennscharf ist von den Anstrengungen der vielleicht vor zehn Jahren oder so auftretenden spekulativen Realisten, die sagten: »Wieso, wir haben doch etwas vor der Sprache und das sind die Dinge.« Und ich finde eigentlich, ich möchte mein Leben ganz gerne damit fristen, durchgehend nicht etwas vor der Sprache anzunehmen – oder annehmen zu müssen. Wo komme ich damit hin? Also, wenn man jetzt sagt: »Wir hatten doch – oder wir haben doch – archäologische Funde, die irgendwelche versteinerten Flugechsen oder sowas sind und die uns klarmachen, da gab es noch keine Menschen, also gibt es etwas vor der Sprache.« Da will ich nicht hindenken, weil ich das Gefühl habe, das nimmt mir etwas anderes als Errungenschaft wieder weg, nämlich die sich doch eher auf Sprache verlassende Dimension der politischen Dekonstruktion von Dingen, weil es so in Richtung Essentialismen deuten würde. Ich habe einfach Angst davor, weil ich denke, es könnte auch der politische Gegner sein, der damit kommt. Der mir das wegnehmen will, wo man schon hingedacht hat als Zivilisationsprozess, der eine gewisse Dinglichkeit auch hinter sich lassen kann, zum Beispiel Körper. Damit sind wir ja auch beim Genderdiskurs: Die Vorstellung, dass der Körper eben etwas Gegebenes ist – und das wollten uns auch die Hirnforscher verkaufen.
Wobei die ja inzwischen auch schon wieder vorsichtiger geworden sind. Vor einigen Jahren waren extrem biologistische Argumentationen in der Tat sehr stark, aber das hat sich, so mein Eindruck, wieder deutlich relativiert.
Wohin eigentlich relativiert? Ich habe da nicht so den Überblick … Ich kriege auch mit, dass das so gesagt wird, aber ich weiß nicht – was konnten die zurücknehmen?
Ich habe den Eindruck, dass da doch inzwischen mehr Skepsis herrscht und nach einigen vielleicht sehr steilen Thesen zunehmend differenzierter und viel vorsichtiger kommuniziert wird. Vielleicht ist es auch eine Frage, wie diese Ansätze öffentlich rezipiert worden sind, und dass die Neurowissenschaftler selbst das Gefühl hatten, dass ihre Erkenntnisse doch zu stark verkürzt worden sind, sodass von Forschern wie Wolf Singer und Gerhard Roth etwa in dem »Manifest« 2004 schon auch deutlich betont wird, wie wenig man letztendlich darüber weiß, was physisch messbare und visuell zeigbare Vorgänge letztlich bedeuten. Dass man, selbst wenn man bildgebende Verfahren hat, damit längst nicht alle geistigen Vorgänge erklären kann und es wohl auch auf absehbare Zeit nicht können wird.
Interessanterweise glaube ich sogar, mit dem Fortschreiten von deren Erkenntnisprozessen wird immer klarer, dass das ein asymptotischer Prozess ist, der niemals zu dem Punkt kommen wird, wirklich in Deckungsgleichheit zu geraten und alles anhand von Gehirnströmen erklären zu können. Diese Restmenge wird sozusagen unter der Lupe sehr groß und deswegen kann man sich vorstellen, dass es ganz natürlich ist, dass sie, je weiter sie kommen, desto mehr relativieren müssen, was die Urannahme war. – Jedenfalls, als ich letztes Jahr Writer in Residence in St. Andrews war, wurde mir von der Mediävistin Bettina Bildhauer ein Buch zum materialistischen Feminismus empfohlen, ein Reader, den ich jetzt immer noch nicht gelesen habe, der mich aber täglich auf meinem Schreibtisch anschaut. Wo ich mich frage, inwiefern man da auch mit den Körpern, ohne essentialistisch zu werden, umgeht. In meinem nächsten Buch habe ich das ein bisschen im Griff über eine Konstruktion, die auch durchaus mediävistisch ›gefuelled‹ ist, nämlich über die Vorstellung von Reliquien, die sozusagen über sich selbst hinausweisen, die quasi nicht ›das Ding an sich‹ sind.
Das Thema hattest du auch bei »Jungfrau« schon, die Frage nach Transsubstantiation. Das arbeitet ja auch immer genau an dieser Grenze oder diesem Changieren zwischen reiner Konstruktion und einem physischen Korrelat. Das zusammenzudenken, darum ging es dort auch schon, und da setzt du jetzt wieder an?
Ja, das hat mich nach wie vor nicht losgelassen, diese Vorstellung von einer Transsubstantiation: dass man praktisch im Symbol, im Zeichen, das Ding selber sieht. Aber man hat natürlich trotzdem ein Zeichen vor sich. Das ist ein sehr interessanter, nicht essentialistischer Gedankengang. Ich finde es spannend, dass Mediävist*innen wie Regina Töpfer, die ich letztes Jahr an der TU Braunschweig kennengelernt habe, oder Andreas Kraß Mediävistik mit Queer Studies verbinden. Oder eben meine große Heldin Caroline Walker Bynum aus den USA, die schon in meinem Roman »Tomboy« von vor mehr als 20 Jahren wegweisend war mit ihrem Buch »Fragmentation and Redemption«, in dem es auch um den Diskurs um den Verbleib der Vorhaut Jesu ging, ob sie nämlich zum Himmel aufgefahren ist oder nicht. Was sehr lustig wirkt, aber irgendwie ein wahnsinnig interessanter Punkt ist, an dem man, vielleicht zum ersten Mal, einen Diskurs über die Fragmentierung von Körpern hat, der sehr klug und sehr differenziert ist und auch mit einem Erkenntnisinteresse abläuft. Und in ihrem Buch »Jesus as Mother« hat sie Jesus als eine Figur beschrieben, die ohne jegliches Zutun von männlichen Elementen zur Welt gekommen ist; es gibt keinen biologischen Vater, Jesus ist praktisch genetisch weiblich und auch seine ganze Rolle in der Bibel, im Neuen Testament, ist eine komplett unmännlich definierte.
Für meinen nächsten Roman hatte ich Lust, den Fokus vom Setting her mal wieder ein bisschen von der Metropole, den Hip-Zirkeln weg zu verlagern und eher mal wieder wohin zu gehen, wo man den Hebel anders ansetzen muss als nur bei aktueller Popmusik, im Nachtleben, in Clubs oder, wie in meinem letzten Roman, bei androgynen Fotomodels. So bin ich jetzt mal wieder in den Odenwald gegangen wie bei »Tomboy« schon. Dieses Mittelgebirge ist natürlich auch kein unschuldiges, da sind die Nibelungen drin herumgelaufen und da ist auch zum Beispiel das Hotel, in dem die Familie Adorno in Amorbach immer Urlaub machte, und da geht mein Roman los. Ich muss jetzt eben diesen ganzen Begriff der Materialität, auch mit Adorno und dem Marxismus, nochmal angehen, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich als Popist unglaublich von Benjamin geprägt bin. Ich habe immer gedacht: »Ich habe ja Walter Benjamin, der arbeitet auf eine mir sehr nahestehende Weise mit den Topoi der populären Kultur, seit er die Baudelaire’schen Texte gelesen hat.« Das »Passagenwerk« ist für mich sozusagen die Urszene der heutigen Pop-Linken. Aber zurück zu Amorbach, wo mit diesem Hotel unglaublich interessante Dinge zusammenhängen – ich recherchiere da seit Längerem herum und bin da auch öfter. Ich habe jetzt auch Freunde gefunden – junge Leute –, die mir erklären, die Dialektik bei Adorno sei nicht eine, die den Widerspruch beseitigt, sondern die sehr produktiv mit fortbestehenden Widersprüchen arbeitet.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei meiner eigenen Adorno-Lektüre und auch in vielen Seminargesprächen, dass Adorno allein durch seinen Sprachduktus oft erstmal sehr autoritär wirkt und so der primäre Eindruck der des enorm Pessimistischen und auch tendenziell Doktrinären ist. Aber wenn man die Texte genauer ansieht, kommt da argumentativ durch das dialektische Denken einiges in Bewegung – eben als negative Dialektik, die die Widersprüche nicht in einer Synthese stillstellt. Und speziell mit Blick auf Pop-Kultur ist es ohnehin eine verkürzte Lesart zu sagen: »Der hat die nur ›gebashed‹ und dagegen feierte er die gute Hochkultur von Beethoven bis Schönberg.« Denn eigentlich betreffen die Überlegungen, die er zur Kulturindustrie anstellt, alle kulturellen Bereiche, also auch die klassische Musik oder die Zweite Wiener Schule. Klar kann dieses fortgesetzte Arbeiten mit und am Widerspruch auch manchmal irgendwie frustrierend und desillusionierend sein, aber es steckt eben auch ein intellektuelles Vergnügen darin, das Ganze immer wieder nochmal um eine Ecke zu drehen und dann nochmal zu reflektieren. So kann man Adorno natürlich auch lesen. Man muss sich nur erstmal von dieser Vorstellung verabschieden, dass er eigentlich alles, was Spaß macht, einfach nur regressiv fand, und sich durch diese apodiktisch daherkommende Sprache durchkauen.
Wobei ich da schon vor Jahren von Silvia Bovenschen, mit der ich gut befreundet war, Anekdoten oder überhaupt Erinnerungen an Adorno, bei dem sie ja studiert hat, den sie gut kannte, der sie auch...









