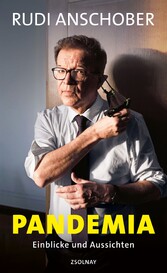
Pandemia - Einblicke und Aussichten

von: Rudi Anschober
Paul Zsolnay Verlag, 2022
ISBN: 9783552072947
Sprache: Deutsch
272 Seiten, Download: 2087 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Es ist da
10. März 2020
Andrea
Das ist keine Grippe
Nur ganz langsam kommt sie aus dem Tiefschlaf zu sich. Sie kann sich nicht sofort orientieren. Was ist mit mir? Der Kopf, die Füße, überall Schmerzen. Ein stechender Schmerz in der Brust. Sie öffnet die Augen. Dunkelheit. Langsam dreht sie den Kopf nach links zum Wecker: kurz nach vier Uhr. Jede Bewegung tut weh und strengt sie an.
Langsam erinnert sie sich, dass sie am Abend mit einem leichten Unwohlsein zu Bett gegangen ist. Es fröstelte sie wie vor einer sich anbahnenden Erkältung. Nichts Ungewöhnliches, ein Zustand wie schon oft zuvor. Sie hat sich früher hingelegt — mit einer Wärmflasche auf dem Bauch war sie rasch eingeschlafen. Morgen würde alles wieder gut sein. Wie so oft.
Langsam beginnt sie sich im Bett aufzurichten. Der Schmerz in der Brust ist stärker geworden. Als ob etwas Schweres auf ihrem Brustkorb liegen würde. Sie sinkt wieder zurück in den verschwitzten Polster, spürt den Pyjama auf der Haut kleben. Sie fröstelt, sie zittert.
Was ist los mit mir?
Und dann kommt der Husten, ein trockener, anstrengender Husten. Beim zweiten Versuch gelingt es ihr aufzustehen. Ein paar Schritte ins Wohnzimmer, die Schachtel mit den Medikamenten aus dem Kasten gezogen, das Fieberthermometer gesucht und gefunden.
Schweißnass vor Erschöpfung schleppt sie sich wieder ins Bett. Nach wenigen Augenblicken piepst das Fieberthermometer: knapp über 39 Grad. Für Andrea, die seit Jahren an leichter Untertemperatur leidet, ein Schock.
Wirre Gedanken gehen ihr durch den Kopf. Sie erinnert sich an die Fernsehbilder der Corona-Krise in Italien: überfüllte Intensivstationen in den Spitälern der Lombardei, Menschen hinter Schutzkleidung, Leichensäcke, abgesperrte Städte, eine Kolonne von Militärfahrzeugen, die anrückt und die Toten aus Bergamo abtransportiert. Die Medien berichten fast ohne Unterbrechung, die Leute sprechen nur mehr darüber.
Angst ist in ihr, Angst hält sie wach. Erst Stunden später, als es längst Tag ist, schläft sie ein. Nach dem Aufwachen ist ihr Zustand nicht besser. Sie erinnert sich an die Aufforderung, im Fall eines Verdachts auf Covid-19 bei der medizinischen Hotline anzurufen. Sie wählt die Nummer. Immer wieder. Stundenlang. Besetzt. Keine Chance durchzukommen. Dann erreicht sie endlich ihre Hausärztin. Sie erzählt von ihren Symptomen.
Andrea, warst du in Italien oder in Asien?
Nein, schon lange nicht mehr.
Dann mach dir keine Sorgen, ich glaube nicht, dass es Covid ist. Ruh dich aus, trink viel Salbeitee, Grippemedikamente hast du ja.
Aber was ist dann los? Sie fühlt sich elend. Als Sportlerin hat sie immer auf ihren Körper geachtet, war selten krank und wenn, dann niemals schwer. So vergehen die nächsten zwei Tage: Sie schluckt Hausmittel, schläft, trinkt Tee, schläft …
Drei Tage lang versucht sie bei der medizinischen Hotline jemanden zu erreichen. Dazwischen hört sie Radio, sieht fern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht inzwischen von einer Pandemie, Todesfälle werden auch aus den Nachbarländern Italiens gemeldet, Reisewarnungen ausgesprochen, erste Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger erlassen. Zehntausende registrierte Infektionen in ganz Europa. Und das dürfte erst der Beginn sein.
Irgendwann wird sie dann doch zu einem Mitarbeiter der Hotline durchgestellt und kann ihm ihre Symptome schildern. Auch der vermutet letztlich Grippe. Doch damit will sie sich nicht abfinden, es ist etwas anderes, sie weiß es. Und ruft immer wieder an, in der Hoffnung, einen anderen Mitarbeiter zugeteilt zu bekommen. Viele Stunden lang, bis man ihr zusagt, einen Sanitäter für einen Covid-Test zu schicken. Endlich.
Während sie wartet, sitzt sie an ihrem Küchentisch, trinkt weiter Salbeitee. Er schmeckt anders, milder, eigentlich schmeckt er nach gar nichts mehr. Später an diesem Tag kommen zwei freundliche Sanitäter in Andreas Wohnung. Sie nehmen sich Zeit, fragen nach den Symptomen, ob sie in einer Risikoregion gewesen sei. Obwohl Andrea laut sämtlichen Berichten inzwischen selbst in einer Risikoregion lebt. Aber sie fühlt sich ernst genommen, fasst Vertrauen.
Das wird jetzt ein bisschen unangenehm, sagen die Sanitäter, aber langsam kriegen wir Übung. Sie nehmen einen Abstrich aus Rachen und Nase und kündigen das Ergebnis der Auswertung für die nächsten Tage an. Zehntausende wollen jetzt getestet werden, darauf sei man nicht vorbereitet. Wir werden überrollt. Es fehlt an Test-Kits, an Schutzmasken, an Laborkapazität. Aber wir geben alle unser Bestes. Den schwersten Job hätten die Telefonistinnen und Telefonisten an der Hotline. Bis vor kurzem gab es nur ein paar hundert Anrufe in der Woche. Jetzt sind es Zehntausende pro Tag.
Sie ist so erleichtert, dass sie getestet wird und sich endlich jemand um sie kümmert, dass ihr die Tränen in die Augen schießen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass es euch gibt. Und dann legt sie sich wieder hin, schläft.
Die nächsten Tage vergehen wie hinter einem Schleier: dahindämmern, Pressekonferenzen der Regierung im Fernsehen, schlafen, Telefonate mit ihrer Ärztin und mit Freunden, wieder wegdämmern. Hoffen, dass rasch ein Testergebnis kommt. Hoffen auf Klarheit. Denn eine Grippe ist das mit Sicherheit nicht.
Zwölf Tage nach den ersten Symptomen, zwölf Tage voller Angst und Schmerz, dann läutet endlich das Telefon: Covid-19-positiv, verpflichtende Quarantäne, teilt ihr die Amtsärztin selbst mit, sie ist zwar gestresst, aber freundlich.
Andrea ist beinahe erleichtert und hat zugleich Angst. Erleichtert, weil endlich Klarheit gegeben ist. Aber die Angst ist nicht weg, weil sie weiß, dass das Virus tödlich sein kann. Wieder schläft sie, jetzt aber anders, tiefer und ruhiger. Dann, in einer dieser kaum mehr unterscheidbaren Nächte, schreckt sie auf. Der Druck auf ihre Brust ist stärker geworden. Es ist, als würde ein Elefant auf ihr sitzen. Sie gerät in Panik, ruft den Ärztenotdienst. Als der Arzt die Wohnung betritt, trägt er einen Schutzanzug, Schutzschuhe, eine Schutzhaube, eine Schutzbrille. Immerhin sieht Andrea seine Augen hinter den Gläsern. Er stellt die ihr schon bekannten Fragen, prüft den Blutdruck (viel zu niedrig), die Sauerstoffsättigung des Blutes (viel zu gering), gibt ihr ein Schmerzmittel und bietet ihr an, sie ins Krankenhaus einzuliefern. Andrea lehnt ab. Wenn ich sterben muss, dann zuhause, denkt sie. Ich höre täglich, wie überfüllt die Spitäler sind. Ich will niemandem das Bett wegnehmen, der es womöglich dringender braucht, sagt sie.
Schlafen. Dahindämmern. Schlafen. Kein Fernsehen mehr, zu anstrengend.
So ziehen sich die Tage dahin, aber dann geht es ihr langsam besser. Tee, Schmerzmittel, Telefonate mit Freunden, darunter zwei Ärztinnen, Informationssuche auf Twitter, wieder Pressekonferenzen der Regierung im Fernsehen. Jemand scheint sich um das alles zu kümmern.
Andrea fühlt sich zwar weiterhin sehr krank, aber der unerträgliche Druck auf der Brust nimmt ab. Nach vier Wochen ist sie erstmals fieberfrei. Ein Glücksgefühl stellt sich ein: Sie ist nicht auf der Intensivstation gelandet, sie hat überlebt.
...








