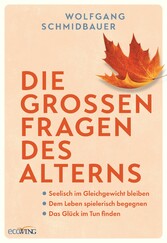
Die großen Fragen des Alterns - Seelisch im Gleichgewicht bleiben - Dem Leben spielerisch begegnen - Das Glück im Tun finden
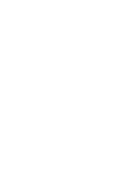
von: Wolfgang Schmidbauer
ecoWing, 2022
ISBN: 9783711053329
Sprache: Deutsch
288 Seiten, Download: 2442 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Die großen Fragen des Alterns - Seelisch im Gleichgewicht bleiben - Dem Leben spielerisch begegnen - Das Glück im Tun finden
EINLEITUNG
Beim Wandern habe ich eine Abzweigung verpasst, die Markierungen stimmen nicht mehr, ein ungutes Gefühl macht sich breit. Weitermarschieren, wird schon gut gehen? Oder umkehren und herausfinden, wo der Fehler steckt? Um das zu entscheiden, muss ich erst einmal stehen bleiben und mich orientieren. Für solche Momente im Lebensweg ist dieser Text gedacht.
Arbeiten und lieben können ist Sigmund Freuds lakonische Definition der seelischen Gesundheit. In Beruf und Beziehung ist es gut, auf einem Weg zu bleiben, der beide Fähigkeiten erhält, die Freude an der Arbeit und die an der Liebe. Das gilt das ganze Leben lang, gewinnt aber im Alter an Bedeutung. Es wird dann schwieriger, Fehler zu korrigieren. Klüger wäre es gewesen, sie nicht zu machen.
Das psychische Feld, in dem sich Alter und Jugend überschneiden, beginnt bei einem Leistungssportler mit fünfundzwanzig Jahren, bei anderen erheblich später. In diesem Feld können sich neue Ansätze ergeben, neue Entwicklungen beginnen. Die körperliche Basis des Selbstgefühls stellt das Ich in jedem Fall vor die Aufgabe, sich damit abzufinden, dass die Spielräume enger geworden sind. Künftig besteht die Aufgabe darin, standzuhalten und nicht unter ein erreichtes Niveau zu sinken, was ebenso viel Energie beanspruchen wird wie die Steigerung der Leistung in jungen Jahren.
Früher oder später hören wir den Spruch: Das einzige Mittel gegen Altwerden besteht darin, jung zu sterben. Er stellt sich in seiner drastischen Banalität den Rezepten in den Weg, die mit dem Schlagwort forever young einem vielleicht noch älteren Mythos huldigen: Es gibt irgendwo einen Ort, wo göttergleiche Gestalten in ewiger Jugend leben. Wer sich gesund ernährt, Sport treibt und rechtzeitig, aber auch regelmäßig den plastischen Chirurgen aufsucht, nähert sich diesen Unsterblichen.
Säugetiere beginnen zu altern, sobald sie erwachsen sind; wir Menschen machen da keine Ausnahme, was den Körper angeht, wohl aber in der Art, wie wir dieses Geschehen erleben. Wir wissen vom Altwerden, und sobald wir erwachsen sind, ist uns auch klar, dass es uns bevorsteht. Auf der anderen Seite ist nur ein Teil unserer Psyche von Reifungsprozessen beeinflussbar; ein nicht weniger wichtiger Teil bleibt ewig jung. Wir können uns ewig jung denken, wir haben Anlass dazu, denn auch ein Achtzigjähriger kann sich verlieben oder, alltäglicher, »kindisch« freuen, wenn ihm etwas geglückt ist.
Ein Kind idealisiert das Leben eines »Großen«;Erwachsene aber tun gut daran, diese Idealisierung infrage zu stellen, denn sie begründet einen gefährlichen Prozess, der uns hier in seinen vielen Facetten beschäftigen wird: die manische oder auch optimistische Abwehr, die sich mit dem Bild einer idealisierten, ewigen Stärke und Jugend verbindet und uns blind macht für einen realistischen Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen. Wenn die manische Abwehr zusammenbricht und wir erkennen müssen, dass wir nicht so stark, sicher und unverwundbar sind, wie wir es uns eingebildet haben, empfinden wir heftige Angst, Leere und Mutlosigkeit, fühlen uns im Bett nicht wohl und fürchten doch, es zu verlassen. Es ist schwierig, aus solchen Zuständen herauszukommen, die sich in der modernen Gesellschaft häufen. Denn die Depression lähmt auch die Mittel, die das Ich bräuchte, um sie zu bezwingen.
Möglich ist es jedoch, die manische Abwehr zu erkennen und ihr den kritischen Blick auf ihre Verblendung entgegenzusetzen. Das haben Künstler, Komiker und jene Kinder schon immer getan, die als Einzige wagten, den Kaiser nackt zu sehen. Nicht die Prediger des Erhabenen schützen uns vor der Depression, sondern die Kritiker, die Spötter, die Zyniker. Sie warnen uns vor dem Sirenengesang der Verleugnung.
Eine technische Lösung, die den Menschen zum »Prothesengott« (das Wort prägte Freud) macht, kettet ihn in eben dem Versprechen, es aufzuhalten, an das Alter. Wer sich jeden Tag davon bestimmen lässt, möglichst jung zu erscheinen, gar sich jung zu fühlen, zahlt mit der dauernden Sorge, alt zu werden. Er kann nicht in einen Zustand finden, der – statt eine Antwort zu geben – die Frage nach dem Jungbrunnen außer Kraft setzt: die Selbstvergessenheit.
Für sie gibt es viele Namen. Der antike griechische Dichter Homer nannte sie Muse und beschrieb sie als Göttin, die den Sänger zu seinen Versen inspiriert.1 Weltlicher fasst es Friedrich Schiller: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«2 Friedrich Nietzsche schwärmt von der Macht selbstvergessener Ideen beim Wandern im Engadin. In der modernen Psychologie hat sich Mihály Csíkszentmihályi mit seiner Beschreibung entsprechender Erlebnisse als »Flow« einen Namen gemacht. Er siedelt den selbstvergessenen Zustand zwischen Überforderung und Langeweile an – ein Tätigsein, in dem wir ganz bei der Sache sind und störende Reize ebenso wie Erfolgsdruck ausblenden.3
Selbstvergessenheit ist zugleich erhaben und alltäglich. Sie wird uns geschenkt, ohne dass wir uns um sie bemühen; erst nachträglich begreifen wir, was wir an ihr hatten. Wir können sie nicht machen, sie entsteht spontan und endet ebenso. Sie lässt sich also nicht technisch herstellen; das verbindet sie, ebenso wie ihre Nähe zum Spiel, mit dem künstlerischen Tun.
Aus dieser Überlegung ergibt sich eine Strategie: Die Vorbereitung auf das Alter ist die Pflege der Möglichkeiten, selbstvergessen zu bleiben. Das widerspricht dem Schlagwort vom Ruhestand ebenso wie dessen ironischem Konterpart, dem Unruhestand. Es geht darum, Zustände zu finden und zu bewahren, die uns sozusagen mit dem Gefühl erfüllen, lebendig zu sein, und dadurch die charakteristisch ängstlich-depressive Tönung auslöschen, mit der sonst das Alter als Dahinschwinden, Devitalisierung, Tonusverlust von Leib und Seele erlebt wird. Ob wir tanzen oder malen, musizieren oder lieben, im Garten arbeiten oder in dem Beruf tätig bleiben, der uns interessiert: Alles, was in der Mitte zwischen Stress und Langeweile liegt, sorgt dafür, dass wir uns weder jung noch alt fühlen, sondern im Einklang mit uns und unserem Tun.
Aus der Sicht der vergleichenden Anatomie ähnelt der Homo sapiens einem voll entwickelten Schimpansenfötus – ein als Neotenie beschriebenes Phänomen. Menschenaffen gleichen in den intrauterinen Stadien ihrer Entfaltung erwachsenen Menschen weit mehr als erwachsenen Schimpansen oder Gorillas, vor allem, was das Verhältnis von Gebiss und Gehirn angeht. Man kann diese Tatsache rein symbolisch auffassen oder als ein organisches Fundament des spezifisch Menschlichen betrachten – wie auch immer, sie läuft darauf hinaus, dass Menschen womöglich nie ganz erwachsen werden.
Während andere Säugetiere als Erwachsene nur noch das Nötige tun, spielen Menschen bis ins hohe Alter, was auch bedeutet: Sie sind kreativ, sie lassen sich etwas einfallen, sie finden neue Lösungen. Das betrifft auch das Altern. Denken wir rechtzeitig und gründlich über unsere Ängste vor seinen negativen Aspekten nach, entstehen Gegenkräfte. Sie helfen uns, im Ernstfall vorbereitet zu sein.
Johann Wolfgang von Goethe hat davon gesprochen, Altern sei ein »Geschäft«, das man erlernen müsse wie andere Geschäfte auch. Es geht darum, sich etwas einfallen zu lassen und sich nicht damit abzufinden, dass die Jugend dahinschwindet, dass man immer weniger wird und seinen Stolz am besten dadurch rettet, dass man Sex, Sport und Reisen schon aufgibt, bevor es wirklich nötig ist.
Um die Jahrtausendwende schrieb ich, kurz vor meinem sechzigsten Geburtstag, ein Buch mit dem Titel Altern ohne Angst. Zwanzig Jahre später befragten mich zwei Redakteure des ZEITmagazins, wie sich meine Gedanken an mir bewährt hätten. Auf das Interview hin kamen Fragen nach dem vergriffenen Text; sie unterstützten die Absicht, mich der Thematik noch einmal anzunehmen – und so ist dieses Buch entstanden. Ich wollte es ursprünglich Die Kunst des Alterns nennen, fand dann aber den sachlicheren Titel von den großen Fragen des Alters treffender.
Ein Therapeut altert mit seinen Patientinnen und Patienten. Ältere Menschen gehen nicht gern zu einem Psychoanalytiker, der erheblich jünger ist als sie selbst – und dieser erwidert solche Gefühle. Ein junger Therapeut ist recht wehrlos, wenn ihm ein alter Patient, eine alte Patientin sagt, er könne sich nicht vorstellen, wie das sei, alt zu werden. Seit mir die Kassenpraxis im Jahr 2000 genommen wurde,4 arbeite ich vermehrt mit Paaren und habe viele Erfahrungen mit der Dynamik langjähriger erotischer Beziehungen gesammelt.
Es gibt in der Auseinandersetzung mit dem Alter keine vorgefertigten Lösungen, sondern nur Unikate. Die Kunst des Alterns orientiert sich an einer Unterscheidung, die der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss eingeführt hat: die zwischen dem...








