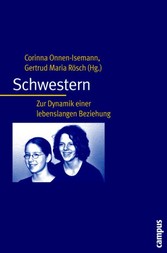
Schwestern - Zur Dynamik einer lebenslangen Beziehung
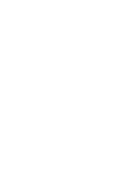
von: Corinna Onnen-Isemann, Gertrud Maria Rösch (Hrsg.)
Campus Verlag, 2005
ISBN: 9783593378466
Sprache: Deutsch
232 Seiten, Download: 1416 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Zwischen Verbundenheit und Differenz: Zum Mythos Schwesternschaft in weiblichen Zusammenschlüssen (S. 89-91)
Renate Liebold und Birgit M. Hack
Einleitung
In der Mitte des 20. Jahrhunderts fasst die Sozialphilosophin Simone de Beauvoir das Geschlechterverhältnis in kritischer Perspektive mit dem Begriffspaar Transzendenz und Immanenz (Beauvoir 1968: 402). Die Tradition der Gleichsetzung von Männlichkeit mit Öffentlichkeit und Status und die Festlegung der Frauen auf die enge Sphäre des Heims, also ihr Ausschluss aus öffentlichen Räumen, gehe tendenziell mit einer Abwertung von Freundschaften unter Frauen und einer Aufwertung von Beziehungen zu Männern einher. Frauen seien nach der Welt der Männer ausgerichtet; demnach sei es für Frauen weitaus schwieriger als für Männer, geschlechtsexklusiven Beziehungsnetzen einen hohen Wert beizumessen. Auch die Beziehungen, die Frauen untereinander eingehen, hätten prinzipiell eine andere Qualität als die Beziehungen, die zu Männern geknüpft werden: Sie scheinen primär den Charakter von Notgemeinschaften oder Gesinnungsgemeinschaften zu haben, die das Bedürfnis von Frauen nach Rückhalt und Austausch erfüllen. Dieses Ergebnis korrespondiert auch mit neueren Untersuchungen, die behaupten, männliche Zusammenschlüsse seien interessegeleitet und sicherten die Kontrolle über zentrale Ressourcen in gesellschaftlichen Institutionen (vgl. Völger/ Welck 1990), der weibliche hingegen bringe keinen Vorteil mit sich in Hinblick auf den Standort im gesellschaftlichen Raum. Status und Ressourcen von Frauen würden sich vielmehr anhand der gesellschaftlichen Stellung der Männer bemessen, zu denen sie in Beziehung stehen.
Im Gegensatz zu den vielfältigen Möglichkeiten des Zusammenschlusses für Männer, waren der Organisationsfähigkeit von Frauen lange Zeit enge Grenzen gesetzt; Frauen waren aus dem öffentlichen Leben nahezu ausgeschlossen (Frevert 1995). Ihr Aufholprozess beginnt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, in dem es der ersten deutschen Frauenbewegung gelang, Frauen in Verbänden und Vereinen zusammenzuschließen (vgl. dazu Gerhard 1995; Nave-Herz 1993). Heute hingegen existieren eine Vielzahl, nach Organisationsform und Themenbereich höchst unterschiedliche weibliche Zusam menschlüsse. Deren historische Entstehungszusammenhänge sind beschrieben, quantitative Bestandsaufnahmen aufbereitet und dokumentiert. Was bislang fehlt, ist eine Analyse der Binnenperspektive der in weiblichen Zusammenschlüssen agierenden Frauen. In diesem Beitrag soll anhand eigener empirischer Forschungsergebnisse ein Beitrag zur Rekonstruktion der Binnenperspektive weiblicher Gemeinschaften geliefert werden. Forschungsleitend sind Fragen nach den zentralen Orientierungen in Zusammenschlüssen von Frauen, die umschrieben werden können mit Notgemeinschaft, emotionaler Gesinnungsgemeinschaft oder Interessengemeinschaft. Ferner sollen die Motive für das Engagement und die Erfahrungen in einer rein weiblichen Gemeinschaft erhoben und analysiert werden.
Das Sample umfasst 17 Frauengruppen, mit denen Gruppeninterviews geführt wurden. Bei der Auswahl der Gruppen wurde darauf geachtet, Frauen unterschiedlicher Alters-, Bildungs- und Herkunftsmilieus zu repräsentieren und zugleich die Vielfalt der Organisationsformen zu berücksichtigen: traditionelle Vereine und Verbände, feministische Projekte und Initiativen, Selbsthilfegruppen und exklusive Service-Clubs als auch solche Zusammenschlüsse, die neuerdings unter der Chiffre »Netzwerk« firmieren.
Der folgende Beitrag fokussiert die Praktiken der Herstellung von Verbundenheit und die Erfahrung der Differenz im sozialen Feld von weiblichen Gemeinschaften. Es wird mittels einer exemplarischen Fallanalyse eines berufsbezogenen Frauennetzwerkes die Art und Weise gezeigt, in der gemeinsame Orientierungen im Gespräch ausgebildet, weitergegeben und umgewandelt werden. Orientierungen speisen sich aus gemeinsamen Erfahrungen und verweisen auf das soziale Milieu der jeweiligen Kommunikationsgemeinschaft. Egal ob Ereignisse des Berufslebens, Episoden aus dem privaten Lebenskon text, Alltägliches oder Wissensdiskurse besprochen werden, die Gesprächsgemeinschaft greift in jedem Fall auf ein generalisiertes Verfahren zurück, um ein für alle Beteiligten relevantes – wenn auch oft unter den Beteiligten kontroverses – Verständnis des Themas zu gewinnen. Diese kommunikativen Prozeduren stehen im Mittelpunkt der empirischen Analyse. Die soziale Identität der Gruppe, so zeigt sich, entsteht in einem interaktiven Prozess, der aus den Bedingungen seines Vollzugs verstanden werden kann.
Als Ergebnis kann an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen werden, dass der weibliche Zusammenschluss Ausdruck einer geteilten Welt ist. Frauen definieren sich in Abgrenzung zu Männern und die Geschlechtlichkeit ist den Frauen permanent präsent. Es wird deutlich, dass die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht Gemeinschaft stiftet und gestaltet, zugleich aber die nicht selten metaphorisch aufgeladene Erwartung an eine schwesterliche Verbundenheit im Sinne von Fraglosigkeit und Selbstverständlichkeit enttäuscht und deshalb immer wieder vermittelt und neu hergestellt werden muss.







