
Literatur und Medien
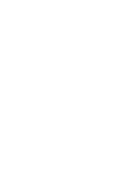
von: Jutta Wermke (Hrsg.)
kopaed, 2003
ISBN: 9783935686327
Sprache: Deutsch
321 Seiten, Download: 2927 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
| Inhaltsverzeichnis | 6 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| „Medien im Deutschunterricht“ Vorwort zum Jahrbuch | 10 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| „Literatur und Medien“ Einleitung zu diesem Band | 14 | ||
| Themen-Schwerpunkt | 19 | ||
| Ralph Köhnen (Bochum) Die Prosa der Ge-Stelle und ihre Chancen Zur mediologischen Grundierung des Erzählens im 19. Jahrhundert | 20 | ||
| 1. Eine kleine Geschichte des Auges | 20 | ||
| 2. Das enthusiastische Auge: Die Luftfahrten Jean Pauls | 23 | ||
| 3. Gefahren des Sehens – E.T.A. Hoffmann | 28 | ||
| 4. Der Autor als Naturwissenschaftler: Adalbert Stifter | 32 | ||
| 5. Fotografie und Film – der kalte und der schnelle Blick | 35 | ||
| 6. Ausblick | 38 | ||
| Petra Josting (Essen) Der Einfluss von Medien-Orientierungen auf die Rezeption Untersucht am Beispiel einer hypermedialen Detektivgeschichte | 43 | ||
| 1. Reaktionen auf veränderte Medienwelten | 43 | ||
| 2. Medien-Orientierungen von GymnasialschülerInnen in der sechsten Klasse | 46 | ||
| 3. Rezeption und Wahrnehmung einer hypermedialen Detektivgeschichte | 50 | ||
| 3.1. Parasoziale Interaktionen oder: das Verhältnis der SpielerInnen zu den Figuren | 51 | ||
| 3.2. Navigationskompetenz als Element von Medienkompetenz | 57 | ||
| 3.3. Schreibkompetenzen | 60 | ||
| 4. Fazit Es bewährt sich, alle Medien maßvoll zu nutzen! und: Kompetenter Medienumgang will am jeweiligen Medium erlernt sein! | 63 | ||
| Petra Wieler (Berlin) Narratives Lernen im medialen Umfeld Eine didaktische Herausforderung | 68 | ||
| 1. Beispiel: Vorlesesituation | 70 | ||
| 2. Beispiel: Schreibkonferenz | 72 | ||
| 3. Beispiel: Unterrichtsgespräch Eine 2. Klasse zu „Prinz Neumann“ von Jutta Richter | 74 | ||
| 4. Beispiel: Schülerinteraktion Zur CD-ROM „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar | 78 | ||
| 5. Beispiel: Niklas und der Wasserzombie | 81 | ||
| Axel Krommer (Erlangen-Nürnberg) Chatten mit dem lyrischen Ich Ein literaturund mediendidaktisches Experiment | 88 | ||
| 1. Begründungstheoretische Defizite: Der rationalistische Fehlschluss und das Primat der Technik | 88 | ||
| 2. Versuch einer Begründung des Chat-Einsatzes im Lyrikunterricht | 91 | ||
| 2.1. Fachwissenschaftliche Vorüberlegungen: Das lyrische Ich – eine problematische Kategorie | 91 | ||
| 2.2. Medientheoretische Vorüberlegungen: Spezifika der Chat-Kommunikation | 93 | ||
| 2.3. Verzahnung von Fachwissenschaft und Medientheorie: Parallelen zwischen lyrischem und virtuellem Ich | 95 | ||
| 2.4. Didaktische Implikationen der Verzahnung von Fachwissenschaft und Medientheorie | 96 | ||
| 3. Abschließende Bemerkungen | 101 | ||
| Dagmar von Hoff (Hannover) Video-Kunst und Fresken für Kinder Bill Violas begehbare Bilderräume | 105 | ||
| 1. Geschichten in ‘alten’ und ‘neuen’ Bild-Medien | 105 | ||
| 2. Kinder und Videokunst | 108 | ||
| 3. „Going Forth by Day“ | 109 | ||
| 4. Zusammenfassung im Blick auf didaktische Perspektiven | 113 | ||
| Mette Börder (Osnabrück) Vom Bilderbuch zum multimedialen Hypertext | 119 | ||
| 1. Begründung des Themas | 119 | ||
| 2. Informationen zum Bilderbuch „Irgendwie Anders“ von Kathryn Cave und Chris Riddell | 121 | ||
| 3. Überblick über den Aufbau der Unterrichtsreihe | 122 | ||
| 4. Darstellung der Unterrichtsreihe | 123 | ||
| 4.1. Die erste Unterrichtseinheit: „Auf einem hohen Berg lebt Irgendwie Anders.“ | 123 | ||
| 4.2. Die zweite Unterrichtseinheit: „Irgendwie Anders tut alles, um wie die anderen zu sein.“ | 124 | ||
| 4.3. Die dritte Unterrichtseinheit: „Das Etwas klopft an der Tür.“ | 124 | ||
| 4.4. Die vierte Unterrichtseinheit: „Jeder ist anders, aber das macht nichts.“ | 125 | ||
| 4.5. Die fünfte Unterrichtseinheit: „Zusammen erstellen wir ein Geschichtenbuch mit dem Computer.“ | 125 | ||
| 5. Organisationsbeispiel zur fünften Unterrichtseinheit | 127 | ||
| 6. Abschließende Bemerkungen | 128 | ||
| Jutta Wermke (Osnabrück) Neue Medien im Spiegel fiktionaler Literatur Zu anthropologischen Dimensionen der Medienentwicklung. Ein Seminarbericht | 129 | ||
| 1. Thema „Mensch – Maschine“ | 129 | ||
| 2. Aufbau des Seminars | 130 | ||
| 3. Jugendliteratur | 133 | ||
| 3.1. Textauswahl und Medienbezug | 133 | ||
| 3.2. Didaktische Reflexion | 133 | ||
| 4. Romane für Erwachsene | 136 | ||
| 4.1. Textauswahl und Medienbezug | 136 | ||
| 4.2. Didaktische Reflexion | 138 | ||
| 5. Ausblick | 140 | ||
| Forum | 143 | ||
| Volker Frederking (Erlangen-Nürnberg) Auf neuen Wegen ... ? Deutschdidaktik und Deutschunterricht im Zeichen der Medialisierung – eine Bestandsaufnahme | 144 | ||
| 1. Sprache und Literatur im medialen Wandel | 146 | ||
| 1.1. Sprache im medialen Wandel | 147 | ||
| 1.2. Literatur im medialen Wandel | 149 | ||
| 2. Kindheit und Jugend im Zeichen der Medialisierung | 151 | ||
| 2.1. Identität im medialen Wandel | 151 | ||
| 2.2. Mediale Symbolisierungsformen | 152 | ||
| 3. Resümee | 154 | ||
| Hartmut Jonas (Greifswald) Methoden und Arbeitstechniken des Umgangs mit neuen Medien im Deutschunterricht | 161 | ||
| 1. Zum Problem | 161 | ||
| 2. Methodentheoretische Ausgangspositionen | 162 | ||
| 3. Zur Begriffsbestimmung der Unterrichtsmethode | 164 | ||
| 4. Computerunterstützter und computergestützter Literaturunterricht | 168 | ||
| 4.1. Lernumgebungen | 168 | ||
| 4.2. Lernprogramme | 171 | ||
| 4.3. Lernmethoden | 173 | ||
| 5. Lernphilosophien | 178 | ||
| 6. Schlussbemerkung | 181 | ||
| Wolf-Rüdiger Wagner (Hannover) Der Computer als Werkzeug zur Texterschließung | 183 | ||
| Forschungs-Projekte | 187 | ||
| Peter Schlobinski (Hannover) Sprachliche Aspekte in der SMS-Kommunikation | 188 | ||
| 1. Schreibung und graphostilistische Mittel | 189 | ||
| 2. Tilgungen, Assimilationen und Reduktionen | 193 | ||
| 3. Abkürzungen und Kurzwörter | 195 | ||
| 4. Zusammenfassung und Perspektiven | 197 | ||
| Elin-Birgit Berndt (Bremen) Förderung von Rechtschreibkompetenz durch Interaktion mit digitalen ‘Hilfen’ | 200 | ||
| 1. Die Relevanz einer Untersuchung digitaler Rechtschreibhilfen | 200 | ||
| 1.1. Digitale Rechtschreibhilfen | 200 | ||
| 1.2. Interaktion | 201 | ||
| 1.3. Fachdidaktische Bedeutung | 201 | ||
| 1.4. Digitale Medien als „Denkzeug“ | 202 | ||
| 2. Rechtschreibkompetenz in der Sekundarstufe I | 202 | ||
| 3. Eine explorative Studie zur Interaktion von Schülern mit digitalen Rechtschreibhilfen | 203 | ||
| 3.1. Definition von Rechtschreibkompetenz | 203 | ||
| 3.2. Die Hypothesen | 205 | ||
| 3.3. Das Untersuchungsdesign | 205 | ||
| 4. Das Repertoire digitaler Rechtschreibhilfen1 | 206 | ||
| 4.1. Die ABC-Prüfung | 207 | ||
| 4.2. Digitale Wörterbücher | 208 | ||
| 4.3. Die Abhängigkeit der Zuverlässigkeit digitaler Hilfen vom Grad der Rechtschreibunsicherheit des Schülers | 209 | ||
| 4.4. Erwartetes Schülerverhalten auf Grund des ‘Tests’ der ABC-Prüfung | 209 | ||
| 5. Die ABC-Prüfung als Rechtschreibbegleiter | 210 | ||
| 6. Ergebnisse der Studie | 211 | ||
| 6.1. Erwartungen | 211 | ||
| 6.2. Methodisches Vorgehen | 212 | ||
| 6.3. Ergebnisse | 214 | ||
| 7. Fazit | 217 | ||
| Berichte | 223 | ||
| Dagmar Wilde (Berlin) Fortbildungskonzept zur Entwicklung neuer Lernkulturen in der Grundschule unter Einbeziehung neuer Medien im Klassenraum Modellversuch des Landes Berlin (in SEMIK) | 224 | ||
| 1. Das BLK-Programm | 224 | ||
| 2. Das Berliner Projekt „ForMeL G“ | 224 | ||
| 3. Erfahrungen mit alternativen Fortbildungsformen | 227 | ||
| 4. Erste Schlussfolgerungen zu Beginn des letzten Projektjahres | 228 | ||
| Gabriele Lehmann (Schwerin) Curricula und Neue Medien Modellversuch des Landes Mecklenburg- Vorpommern (in SEMIK) | 230 | ||
| 1. Ausgangssituation | 230 | ||
| 2. Zum Vorgehen im Modellversuch | 231 | ||
| 3. Welche Probleme bestehen? | 234 | ||
| Hartmut Jonas (Greifswald) Entwicklung von Methodenkompetenz zum Wissenserwerb in den neuen Medien Modellversuch des Landes Mecklenburg-Vorpommern (in SEMIK) | 236 | ||
| 1. Ziel des Modellversuchs | 236 | ||
| 2. Problemlage und Lösungsansatz | 236 | ||
| 3. Zu den Ergebnissen | 238 | ||
| Ines Lessing (Hamburg) Lernen mit Notebooks Literatur und Neue Medien im Deutschunterricht der Sekundarstufe I. Modellversuch des Landes Hamburg (in SEMIK) | 239 | ||
| 1. Zielsetzung | 239 | ||
| 2. Ausgangsposition | 239 | ||
| 3. Das Notebook im Literaturunterricht | 241 | ||
| 3.1. Beispiel aus einer Haupt- und und Realschule | 241 | ||
| 3.2. Beispiel aus einer Gesamtschule | 242 | ||
| Karsten Jonas (Kiel) Computer oder Feder? Möglichkeiten des Einsatzes neuer Medien im Deutschunterricht der Oberstufe. Projektbericht im Rahmen eines Modellversuchs des Landes Schleswig-Holstein (in SEMIK) | 246 | ||
| 1. Anmerkungen zum Unterrichtsverlauf | 246 | ||
| 2. Erschließung zentraler Textpassagen | 248 | ||
| 3. Exkurs: PowerPoint zur Präsentation von Arbeitsergebnissen | 249 | ||
| 4. Metaphern in Ossians Gedichten | 250 | ||
| 5. Die Website | 251 | ||
| 6. Fazit | 251 | ||
| Gudrun Marci-Boehncke (Ludwigsburg) „Positiv-sein“: Vernetztes Lernen mit literarischem Kern Ein Projekt der außerschulischen Weiterbildung | 253 | ||
| 1. Der Kontext | 253 | ||
| 1.1. Die Bildungssituation: PISA und die Wissenskluft | 253 | ||
| 1.2. Die Institution ‘Bildungswerk’ | 254 | ||
| 2. Voraussetzungen und Ziele | 255 | ||
| 2.1. Motivation | 255 | ||
| 2.2. Lesekompetenz | 256 | ||
| 2.3. Kommunikationskompetenz | 257 | ||
| 2.4. Medienkompetenz | 258 | ||
| 3. Projektskizze | 259 | ||
| 3.1. Bausteine | 259 | ||
| 3.1.1. Das Buch-Projekt | 259 | ||
| 3.1.2. Das Film-Projekt | 260 | ||
| 3.1.3. Das Internet-Projekt | 260 | ||
| 3.1.4. Das E-Mail-Projekt | 261 | ||
| 3.1.5. Die Talk-Runde | 261 | ||
| 3.1.6. Sport und PR | 261 | ||
| 3.2. Fachdidaktische und pädagogische Dimensionen des Projekts | 261 | ||
| 3.3. Zielvorgabe: Medienkompetenz | 262 | ||
| Andrea Baumert (Hannover) Der Literatur@tlas Niedersachsen Ein Projektbericht | 264 | ||
| 1. Der Literatur@tlas als Teilprojekt der „Internet-Atlanten“ | 264 | ||
| 2. Das Thema | 264 | ||
| 3. Der Arbeitsprozess | 265 | ||
| 4. Der Einsatz der neuen Medien | 265 | ||
| 5. Einige Beispiele | 267 | ||
| 5.1. Leben und Werk der Dichter, die in Lüneburg durch Straßennamen geehrt werden | 267 | ||
| 5.2. Roland Lange – mit Pferden in Kinderherzen | 268 | ||
| 6. Ein Ausblick | 268 | ||
| Service Rezensionen Bibliographien Linkliste | 269 | ||
| Service Rezensionen | 270 | ||
| zu Günter Grass: Im Krebsgang. Eine Novelle. Göttingen: Steidl 2002 | 270 | ||
| Funktionen der Websites in z.B. Ermangelung von Java-Applets bzw. geeigneten Browsern im WWW noch gar nicht verfügbar waren | 272 | ||
| zu Lernsoftware „Deutsch Rechtschreibung 5./6. Klasse“ von HEUREKA Klett. Stuttgart 20011 | 275 | ||
| zu Fachspezifischen Datenbanken im Internet: | 281 | ||
| Service Bibliographien | 284 | ||
| Hörästhetik und Auditive Medien im Deutschunterricht Eine Bibliographie, zusammengestellt von Mette Börder und Jörg Ehrnsberger (Osnabrück) | 284 | ||
| 1. Hören | 285 | ||
| 2. Hörspiel | 288 | ||
| 3. Kinderhörkassetten und CDs | 290 | ||
| 4. Radio | 292 | ||
| 6. Praxisprojekte: Medienproduktion | 300 | ||
| Medien im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache Eine Bibliographie, zusammengestellt von Antje Streit (Osnabrück) | 302 | ||
| 1. Medien als Unterrichtsmittel | 303 | ||
| 2. (Audio)visuelle und Auditive Medien | 303 | ||
| 3. Neue Medien/Computer/Internet | 306 | ||
| Links für DeutschlehrerInnen zusammengestellt von Daniela Menke (Osnabrück) und Maren Steinhoff (Bielefeld) | 309 | ||
| 1. Deutschunterricht allgemein | 309 | ||
| 2. Deutsch als Fremdsprache | 311 | ||
| 3. Nachschlagewerke, | 311 | ||
| 4. Materialien und Anregungen | 313 | ||
| 5. Internetseiten | 314 | ||
| 6. Institutionen | 315 | ||
| 7. Radio, Film und Fernsehen | 317 | ||
| AutorInnen | 318 |







