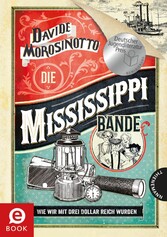
Die Mississippi-Bande - Wie wir mit drei Dollar reich wurden

von: Davide Morosinotto
Thienemann Verlag GmbH, 2017
ISBN: 9783522610681
Sprache: Deutsch
368 Seiten, Download: 11189 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Küchenherd für Holzfeuerung
Wir alle wussten, welchen Katalog sie meinte: den berühmten Versandhauskatalog der Firma Walker & Dawn. »Die niedrigsten Preise! – Geben Sie Ihr Geld klug aus! – Bei Nichtgefallen Geld zurück!« In seiner Werbung behauptete das Versandhaus, sein Katalog sei nach der Bibel das in Amerika meistgelesene Buch. Ich glaube eher, dass der Katalog mehr Leser als die Bibel hatte, denn in unserer Gegend, zum Beispiel, konnten nicht viele Leute lesen und der Katalog hatte Bilder.
Tja, die Bilder! 2000 Seiten voller Artikel und für jeden gab es eine schöne, genaue Abbildung. Es war beinahe so, als hätte man die Ware vor sich.
In dem Katalog gab es Knöpfe, Medikamente, Hammer und Geräte für die Landwirtschaft. Kutschen. Sättel. Schmuck und Uhren, Hüte und Kleidung, Damenschuhe. Gewehre. Angelruten. Boxhandschuhe. Bausätze für ganze Häuser. Egal, was man brauchte, was man sich wünschte, woran man gerade dachte: Man konnte sicher sein, es im Katalog zu finden, zusammen mit einer schönen Zeichnung in Schwarz-Weiß, einer kurzen Beschreibung und natürlich dem Preis.
Monsieur Fabron behauptete, vor vielen Jahren hätte man im Katalog auch afrikanische Sklaven bestellen können, doch ich glaube, das war ein Witz. Monsieur Fabron war ein Scherzkeks. Ich hätte es jedenfalls nicht gut gefunden, wenn man sich Tit aus einem Katalog hätte bestellen können. Oder vielleicht doch, denn dann hätte ich ihn sofort gekauft und ihn Julie geschenkt, damit sie wieder zusammen sein konnten.
Für unsere Bande jedenfalls war der Katalog das Fantastischste, was wir uns vorstellen konnten. Er wurde allen Haushalten im Bayou ungefähr zum Jahresanfang zugestellt und wenn er kam, war das ein Fest, vielleicht ein besseres noch als Weihnachten.
Mama setzte sich abends nach dem Essen mit dem Katalog im Schoß in den Schaukelstuhl. Sie ließ ihren Zeigefinger über die Seiten wandern und wenn sie etwas Interessantes entdeckt hatte, fragte sie mich: »Te Trois, was steht hier geschrieben?«
Ich las es ihr vor.
Dann fragte sie mich immer: »Te Trois, was kostet es?«
Und ich las ihr den Preis vor. Sie lächelte dann, ohne etwas zu sagen, und ihr Finger bewegte sich weiter über die Seite, so als hätte er schon wieder alles vergessen.
Ein Mal, ein einziges Mal nur war ihr Finger an einer Stelle geblieben. Das war vor zwei Jahren gewesen, als unser alter Herd geplatzt war und die Glut auf den Fußboden gespuckt hatte, sodass unser Haus beinahe abgebrannt wäre.
Wir konnten den Herd nicht mehr benutzen und so war es im Haus eine ganze Weile lang kalt geblieben, aber schließlich war es nicht mehr auszuhalten gewesen und Te Cinq, mein jüngster Bruder, hatte sich erkältet und hohes Fieber bekommen und wäre beinahe daran gestorben. Also ein echtes Fieber, nicht so ein geschwindeltes Fieber wie bei Eddie.
Schließlich hatte sich Mama durchgerungen, einen neuen Herd zu kaufen. Viele Abende lang hatte ich ihr immer wieder die Katalogseiten mit den Herden vorlesen müssen, hatte auf ihre Bitte hin ständig die Preise und die Beschreibungen wiederholt und bei jedem hatte sie nur den Kopf geschüttelt, aber am folgenden Abend hatte ich wieder vorlesen müssen.
Der billigste Herd sollte 5 Dollar und 75 Cents kosten, aber mit Versand und allem Drum und Dran kam er insgesamt auf 7 Dollar. Mama ging mit Nina, unserer Stute, in die Stadt und als sie zurückkam, hatte sie die Stute nicht mehr dabei, dafür aber das Geld für den Herd.
Es hatte mir leidgetan, denn Nina war ein gutes Pferd gewesen, und von dem Tag an mussten Te Deux und ich den Wagen ziehen, aber es war eben nicht anders gegangen.
Im Winter hat man einen Herd einfach nötiger als ein Pferd.
Ich merke gerade, ich habe den Faden verloren. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Joju eine großartige Idee gehabt hatte und dass der Katalog mit Sicherheit die Lösung für unser Problem war. Wenn wir unser Geld gemeinsam ausgaben, dann für etwas aus dem Katalog. Wir waren sofort alle einverstanden.
Also drehte ich mit dem Einbaum um und paddelte schnell zu unserer Hütte zurück. Ich zog das Boot an Land und Julie und Eddie halfen mir, es mit Zweigen abzudecken, damit es niemand sah und womöglich noch klaute.
In den Fußboden der Hütte gruben wir ein Loch, legten die drei Dollar hinein und machten das Loch wieder so zu, dass man es nicht mehr sah. Danach begaben wir uns auf den Heimweg. Ich ging voraus, weil ich die sicheren Stellen zwischen dem Treibsand am besten kannte, dann kamen Hand in Hand Tit und Joju, und schließlich Eddie als Letzter.
An der Kreuzung hinter der Wackelbrücke verabschiedete ich mich von den anderen. Eddie wohnte in der Stadt, wo sein Vater die Praxis hatte, während Joju und Tit hinter der Plantage von McCoy in einem Häuschen lebten, das um einiges hässlicher und schiefer war als unsere Hütte.
Und ich … na ja, ich wohnte eben zu Hause.
In unserem Haus lebten wir zu fünft: Mama, mein ältester Bruder Chuck, mein zweitältester Bruder Te Deux, ich und Te Cinq.
Mein Papa starb, als ich noch sehr klein war, deshalb kann ich mich kaum an ihn erinnern. Te Quatre kam ein Jahr nach mir zur Welt und verließ sie wieder, als ich noch Windeln trug, deshalb habe ich keinerlei Erinnerungen an ihn. Mama wollte seinen Namen nicht mehr nehmen, der »der Vierte« bedeutet, deshalb war Te Cinq von Anfang an »der Fünfte« und würde es auch immer bleiben.
Außer Mama waren wir also alle Jungs und sie nannte uns immer »meine kleine Armee«. Das machte mir nichts aus, mich störte nur, dass auch Chuck dazugehörte, der nie irgendetwas tat, außer dumm daherzureden und ständig Kopfnüsse auszuteilen.
Als ich bei unserer Farm ankam, sah ich Te Cinq, der draußen im Schlamm spielte, und Te Deux, der die Tiere fütterte und mir zurief, ich solle ihm dabei helfen.
Ich hatte überhaupt keine Lust dazu, doch Te Deux sagte: »Mach es, glaub mir, das ist besser für dich.«
Ich ging zu ihm hin, nahm ihm einen Eimer Schweinefutter ab und wollte wissen, wie er das meinte. Er antwortete nicht, sondern schenkte mir nur ein schiefes Grinsen.
»Wo warst du heute?«, fragte er.
»Bei Fabron«, erwiderte ich. »Ich habe beim Reparieren der Scheune geholfen.«
»Ach so«, meinte er. »Dann bist du ja sicher müde.«
»Ja, ganz ordentlich.«
»Das will ich glauben.«
Te Deux war 15 Jahre alt und inzwischen genauso groß und stark wie Chuck, aber im Gegensatz zu Chuck war er gutmütig und konnte nicht lügen, man sah es ihm schon an den Augen an.
»Ist etwas passiert?«, fragte ich, doch Te Deux seufzte nur, nahm mir den Eimer ab und kippte den Schweinen ihr Futter in den Trog.
Eine Weile sahen wir zu, wie sich die Schweine gegenseitig vom Trog wegzudrängen versuchten, so als ob wir ihnen irgendwelche tollen Leckereien hineingelegt hätten.
»Geh zu Mama«, seufzte Te Deux. »Sie wartet auf dich.«
Ich kannte meinen Bruder gut genug, um zu wissen, dass ich nicht mehr aus ihm herausholen konnte. Also ließ ich ihn bei den Schweinen zurück und ging die Stufen zur Veranda hinauf. Im letzten Augenblick dachte ich daran, mir die schmutzigen Schuhe an der Matte abzuputzen.
Mama stand in der Küche und rührte in dem Topf mit dem Courtbouillon, einer Fischsuppe, die zufällig auch mein Leibgericht ist.
In der Küche war es unerträglich heiß. Ein schmieriger feuchter Belag bedeckte die Wände und über dem Esstisch kreiste ein Schwarm dicker schwarzer Fliegen.
Als sie mich eintreten sah, blies sich Mama eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Wie an jedem Tag, der seit Papas Tod vergangen ist, war sie ganz in Schwarz gekleidet. Sie hatte sich die Ärmel hochgekrempelt und so konnte ich ihre Muskeln sehen. Sie war so stark, dass sie wahrscheinlich sogar Monsieur Dubois, den stärksten Mann in unserer kleinen Stadt, beim Armdrücken besiegen könnte, wenn sie nur wollte.
»Da bist du ja«, sagte sie.
»Entschuldige, dass ich spät komme, aber wir haben länger gebraucht als gedacht …«
»Und wie geht es Michel?«
Michel Fabron war der jüngste Sohn von Monsieur Fabron. Er war so alt wie ich.
»Sehr gut«, antwortete ich. »Wir waren stundenlang auf dem Dach und es war unglaublich heiß.«
Meine Mutter sah mich an, nur einen kurzen Augenblick lang. Und genau in diesem Augenblick merkte ich, dass etwas nicht stimmte.
»Ach ja?«, meinte sie. »Das freut mich aber, dass Michel es schon heute wieder aufs Dach geschafft hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so schnell wieder erholt.«
Mittlerweile hatte ich die Gewissheit, dass etwas passiert war.
»Gegen drei kam Monsieur Fabron her«, fuhr Mama fort. »Michel ist auf einem Anlegesteg ausgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen und Monsieur Fabron hat sich unsere Kutsche ausgeliehen, um ihn zu Doktor Brown zu bringen.«
Doktor Brown, das war Eddies Vater.
»Und weißt du, was komisch ist? Monsieur Fabrons Scheune musste überhaupt nicht repariert werden. Und als wir in der Stadt waren – ich bin natürlich mitgefahren –, mussten wir erst einmal Doktor Brown suchen, denn der lief überall herum und suchte seinen Sohn. Und er hat mich gefragt, ob ihr, Eddie und du, nicht vielleicht heimlich in den Bayou gegangen seid, um mit irgendwelchem nutzlosen und gefährlichen Zeug die Zeit zu vergeuden …«
Ich seufzte so tief, dass ich es bis in die Zehenspitzen hinein spürte. »Entschuldige, Mama.«
...








