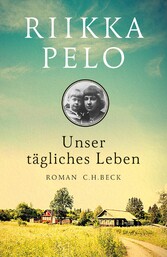
Unser tägliches Leben - Roman

von: Riikka Pelo
Verlag C.H.Beck, 2017
ISBN: 9783406706332
Sprache: Deutsch
495 Seiten, Download: 4573 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Moskau August 1939
Ich stand vor dem frisch gestrichenen Nebengebäude der Klinik. Schon am Morgen war die Sonne erdrückend, der heißeste Sommer seit zwanzig Jahren, an den Rändern von Moskau brannten die Wälder und Torfmoore unter der wütenden Hitze. Rußflocken schwebten in der dicken, heißen Luft langsam aufwärts. Genau wie an der Schwelle zur Revolution, erinnerten sich die Journalistenveteranen bei ZhurGas, damals gingen im Sommer rund um Moskau die Wälder in Flammen auf, das Feuer war ein gutes Omen, das Alte verbrannte vor dem Neuen, dieser Preis musste bezahlt werden.
Ich sah fremd aus in der Milchglasscheibe des Krankenhausfensters, und in meiner Nervosität zündete ich mir eine Zigarette an, bevor ich hineinging. Der August neigte sich dem Ende zu, das Verfahren gegen Kolzow hätte längst zu Ende sein sollen, aber es war noch keine Nachricht über ihn in die Redaktion gelangt.
Die Ärztin war eine Frau in den Vierzigern, ausdruckslos, dennoch freundlich, und beinahe geschlechtslos. Sie glich eher einem Lama als einem Kamel. Schön war sie nicht, auch nicht, als sie die Brille abnahm, die eine Membran vor dem Gesicht zurückzulassen schien.
Ja, ja, seit meiner Ankunft in Moskau war meine Regel so exakt gewesen wie ein deutscher Zugfahrplan, aber die letzte hatte Anfang Juni eingesetzt, vielleicht sogar noch Ende Juni. Am Sonntag hatte ich ausgerechnet, dass ich tatsächlich seit mehr als sieben Wochen meine Tage nicht gehabt hatte, im August blieben sie ganz aus. Meine Brüste waren empfindlich und spannten, und morgens plagte mich Übelkeit, als hätte ich zu viel Luft im Bauch, stundenlang mochte ich nichts essen, obwohl ich den Hunger spürte, meinen alten Kampfgefährten. Ich musste niemanden fragen, um zu wissen, was das bedeutete. Und wenn ich esse, sagte ich der Ärztin, esse ich für zwei.
In Moskau hatte man zu essen, wenn man nur arbeitete, man brauchte keine Steine in der Tasche mit sich herumzutragen oder Sonnenblumenkerne oder saure Äpfel, an denen man lutschen konnte, um den Hunger zu vertreiben, so, wie ich es in Paris gelernt hatte, als ich durch die nach Croissants und Milchkaffee duftenden Straßen des Sechsten Arrondissements gerannt war, um mich in der Zeichenstunde von der großen Künstlerin Gontscharowa demütigen zu lassen.
Ich lag unter dem offenen Fenster auf der Pritsche und betrachtete die gespaltene Schwarzpappel im Hof. Die Ärztin schob die von einem Gummihandschuh umhüllte Hand in mich hinein und drehte das zunächst kalte Spekulum hin und her, wodurch sich mein Unterleib zusammenzog. Ich spürte Harndrang, obwohl ich gerade erst im Badezimmer eine Probe abgegeben hatte.
Versuche dich zu entspannen, Genossin. Dann drückte sie mit den Fingern in mir herum, ob man es schon fühlen konnte, das andere Leben, das ein Teil von mir war. Ich schloss die Augen, ein Baum duftete draußen, noch nicht herbstlich, nicht nach Blättern und auch nicht nach Blüten, sondern nach frisch geborstenem Holz, süß, ein bisschen nach Honig. Ich hatte mir die Bäume draußen nicht genauer angesehen und konnte den Duft nicht zuordnen, aber es kam mir vor, als hätte sich der Baum durchs Fenster geschoben und mich in die Arme geschlossen. Mulja, du bist hier, bei mir, dachte ich. Am richtigen Ort. Alles ist gut. Und alles, was jetzt geschieht, ist richtig. Wenn du zurückkommst, werde ich dir dies alles erzählen, die wundersame Neuigkeit, sie wird unser Leben verändern.
Das ging ja gut, sagte die Frau, als sie den Finger herauszog, und beim Waschen und Abtrocknen der Hände fügte sie hinzu, es sei ganz offensichtlich etwas da. Es klang, als spräche sie von einer Wucherung, einem Geschwür, einem Krankheitsherd. Was?, fragte ich, als hätte ich selbst vergessen, warum ich gekommen war.
Ein neuer Mensch, erwiderte die Ärztin, korrigierte sich aber gleich. Noch könne man es nicht als Menschen bezeichnen. Allerdings sei es in der Gebärmutter bereits zu deutlichen Veränderungen gekommen, die auf eine Schwangerschaft hindeuteten. Trotzdem müsse man die Untersuchung der Urinprobe abwarten. Die Resultate kämen Ende dieser, spätestens Anfang nächster Woche. So lange dauere es, bis das Hormon im Versuchstier zu sehen sei. Die Frau sprach langsam und deutlich, als könnte ich kein Russisch oder als spräche ich es mit dem falschen Akzent, und in ihren Ohren tat ich das vielleicht auch. Ich versprach, am Freitag anzurufen, denn ich wollte nicht, dass so eine Nachricht in Liljas Haus durch fremde Hände ging.
Ich zog mich an und merkte, dass mich schon das Schließen des Reißverschlusses außer Atem brachte. Darüber vergaß ich, nach dem Versuchstier zu fragen, ob Ratte oder Hase, und was mit ihm geschah. Wurde ihm mein Urin in den Organismus gespritzt, und starb es dann wegen mir?
Am Abend rief Marina an. Der alte Sudak hatte den Hörer des Etagentelefons abgenommen und hörte nun aus wenigen Metern Abstand mit, wobei er so tat, als studiere er das Schwarze Brett im Flur. Mir fiel auf, dass seine Kleider nach ranziger Butter rochen, als ich den schwarz gewordenen Hörer in die Hand nahm.
Ist alles in Ordnung?, fragte ich als Erstes, schnell, denn mir war bereits der Gedanke gekommen, dass meinem Vater etwas zugestoßen sein könnte, dass er doch nicht von den Beratungen, die die ganze Nacht über gedauert hatten, zurückgekehrt war.
Marina machte sich gar nicht erst die Mühe, mir zu antworten, sondern gab nur einen müden sarkastischen Ton von sich. Ich fragte sie dennoch, wie es Serjoscha ging, aber sie kam direkt auf ihr eigenes Anliegen zu sprechen. Es war eine Benachrichtigung wegen ihres Reisegepäcks eingetroffen, man solle es im Viertel des Innenministeriums abholen, in der Lubjanka, aber wie sollte sie vom Jaroslawler Bahnhof dort zu Fuß hinfinden, wo doch alle Straßennamen geändert worden waren.
Und natürlich fragte sie, ob ich morgen etwas vorhätte. Ich sagte, ich müsse arbeiten und gerade derzeit gebe es in der Redaktion schrecklich viel zu tun. So ist das doch immer bei dir, sagte sie vorwurfsvoll, du tust ja nichts anderes als arbeiten. Wie auch immer, ich würde sie nicht in die Lubjanka begleiten. Wir waren zwei Wochen zuvor zusammen dort gewesen, um nach ihren Sachen zu fragen, und hatten bei der Gelegenheit gleich versucht, in der Behörde gegenüber Klarheit über das Verschwinden ihrer Schwester zu erhalten. Man hatte uns von einem Schalter zum nächsten rennen lassen, ohne Papiere konnte man keine Information bekommen, nicht einmal über die eigenen Papiere, ein Paket für Anastasia Zwetajewa war auch nicht angenommen worden, man sagte uns, einen Menschen dieses Namens gebe es nicht, keinerlei Vermerk.
Kann diesmal nicht Mur mit dir hingehen, schlug ich vor. Aber Marina wollte nicht, dass der Junge sah, dass es auf dieser Welt solche Orte überhaupt gab, er sei ja noch ein Kind. Mur war vierzehn.
Geh einfach hin, sagte ich, entschlossen, die Geduld nicht zu verlieren, bei Marina musste man resolut sein, mit der Metro kommst du gut hin, du musst nicht einmal umsteigen, du holst deine Sachen ab und quittierst es. Die werden dir schon sagen, was du tun sollst.
Den ganzen Sommer hatte Marina über die Beschlagnahmung ihrer Reisetruhen lamentiert. Sollte sie sich doch freuen, dass sie gekommen waren, aber nein, sie stimmte das gleiche Klagelied an, das ich seit ihrer Ankunft hörte, wie sie einem Menschen nur alles abnehmen konnten, die Koffer, den Pass, das ganze Eigentum, völlig willkürlich; das Gleiche, als man sie zum Schiff brachte, nicht einmal verabschieden durften sie sich, wie Verbrecher wurden sie in den Schiffsrumpf verfrachtet.
Auch diesmal standen keine Papiere in Aussicht. Was fange ich ohne Pass in so einem Land an, setzte sie ihr Klagelied fort, ein unnützes Wesen mit falschem Namen, ohne die Möglichkeit, auch nur einen freien Schritt zu tun.
Aber du hast doch immerhin eine Reiseerlaubnis bekommen, versuchte ich sie aufzumuntern. Ja, dieses eine Mal. Hin und zurück darf ich fahren, sagte sie widerwillig. Das nächste Mal muss ich einen neuen Antrag stellen.
Ich forderte sie auf, sich gerade deshalb über die jetzige Möglichkeit zu freuen, aber darauf schnaubte sie so wütend, dass es besser war, nicht weiter zu versuchen sie aufzuheitern.
Ist etwas passiert?, fragte sie.
Nein. Wieso?
Du klingst – so anders.
Der alte Sudak hatte angefangen, Zettel vom Schwarzen Brett zu entfernen. Er hielt es für den richtigen Zeitpunkt, um die Informationsvermittlung der Kommunalka in Ordnung zu bringen. Ich lächelte ihm freundlich zu. Er wandte den Blick ab. Manchmal kam es mir so vor, als hätten die Menschen Angst vor meinem Lächeln. ...









