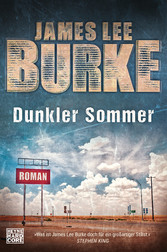
Dunkler Sommer - Roman

von: James Lee Burke
Heyne, 2018
ISBN: 9783641211592
Sprache: Deutsch
560 Seiten, Download: 5058 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Kapitel 1
Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich jeden Morgen von Angst und Beklemmungen erfüllt aufwachte, ohne zu wissen, warum. Angst war für mich eine gegebene Tatsache, eine Konstante, die ich fest in meinen Tagesablauf einkalkulierte, wie einen kleinen Stein im Schuh, den man einfach nicht loswird. Ein Erwachsener mag das rückblickend als eine Form von Mut bezeichnen. Möglich, dass es das war, sonderlich spaßig fühlte es sich allerdings nicht an.
Meine Geschichte beginnt an einem Samstag im Jahr 1952. Es war Frühling, mein Junior-Jahr an der Highschool neigte sich dem Ende zu, und ich hatte mir den Wagen meines Vaters geliehen, um ins fünfzig Meilen südlich von Houston gelegene Galveston zu fahren, wo ich mich mit meinen Highschool-Freunden am Strand treffen wollte. Eigentlich gehörte das Auto gar nicht meinem Vater, sondern war eine Leihgabe seiner Firma; ausschließlich von ihm selbst und nur für Dienstfahrten zu benutzen. Dass er mir den Wagen auslieh, war ein enormer Vertrauensbeweis. Meine Freunde und ich verbrachten einen wunderbaren Tag am Strand, wo wir Touch-Football im Sand spielten. Als sie gegen Abend ein Lagerfeuer errichteten, beschloss ich zur dritten Sandbank südlich der Insel hinauszuschwimmen, der letzten Stelle vor dem offenen Meer, an der die Füße noch den Boden berührten. Das Wasser dort war nicht nur tief und kalt, sondern auch Hammerhairevier. Noch nie zuvor hatte ich das allein versucht, und als ich einmal zusammen mit einer Gruppe von Freunden bis zur dritten Sandbank hinausgeschwommen war, hatten die meisten von uns bereits einiges intus gehabt.
Ich watete durch die Brandung, holte tief Luft, tauchte durch die erste Welle und begann zu schwimmen. Ich erreichte die erste Sandbank, dann die zweite, aber ich hielt nicht an. Ich schwamm weiter und drehte mein Gesicht zwischen den Zügen zur Seite, um Luft zu holen. Dann erblickte ich die letzte Sandbank und sah, wie die Wellen über die Untiefe spülten und die Möwen im Schaum nach Futter pickten.
Ich stellte mich aufrecht hin. Auf meinem Rücken kribbelte der Sonnenbrand. Die einzigen Geräusche, die ich hörte, waren das Gekreische der Möwen und das Platschen des gegen meine Lenden schlagenden Wassers. Ich konnte ein Frachtschiff mit einem Schleppkahn dahinter sehen, die kurz darauf am Horizont verschwanden. Ich warf mich kopfüber in eine Welle und sah unter mir den sandigen Boden in die Dunkelheit gleiten. Das Wasser war plötzlich kühler als zuvor, die Wellen hart wie Beton. Die Hotels, die Palmen und auch das Vergnügungspier am Strand waren auf Miniaturgröße geschrumpft. Eine dreieckige Flosse schnitt durch die Dünung, tauchte in einer Welle unter und hinterließ eine Blasenkette an der Wasseroberfläche.
Dann schnürte sich mein Herz zusammen, aber nicht wegen des Haifischs. Ich war mitten in einen Schwarm von Quallen hineingeschwommen. Es waren große Exemplare mit bläulich-rosafarben schimmernden Gasblasen und hauchzarten Tentakeln, die sich um Hals oder Schenkel eines Menschen schlingen und dort problemlos Schäden anrichten konnten, wie sie auch ein Schwarm gereizter Wespen zustande bringt.
Das Erlebnis mit den Quallen schien wie ein Symbol für mein Leben zu sein: Ganz gleich, wie sonnendurchflutet der Tag auch scheinen mochte, ich wurde stets von einem Gefühl der Gefahr begleitet. Und das war keineswegs eingebildet. Das dumpf dröhnende Brummen einer frisierten Auspuffanlage an einem aufgemotzten Ford Coupé, gefolgt von einem achtlosen Blick in Richtung der Jungs mit den Ducktail-Frisuren, den Velourslederschuhen und den Drapes, und in Sekundenschnelle konnte man zu Brei geschlagen werden. Schon mal eine Dokumentation über die Fünfziger gesehen? Was für ein Witz.
Ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, dass meine Ängste eine Externalisierung der Probleme in meinem Elternhaus waren, und vielleicht hätte er damit sogar recht. Andererseits habe ich mich stets gefragt, wie viele Psychologen schon gegen fünf oder sechs mit Ketten, Spring- oder Rasiermessern bewaffnete Kerle angetreten sind; Kerle, die es nicht interessiert, ob sie leben oder sterben, und die Schmerz wie Eiscreme runterschlucken. Vielleicht sah ich die Welt aber auch nur als undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel, und war in Wahrheit selbst das Problem. Tatsache ist, dass ich immer Angst hatte. Wie an jenem Abend, als ich durch die Quallen schwamm. Die Berührung mit nur einer von ihnen war so gefährlich, wie ein Elektrokabel anzufassen, und meine Furcht so groß, dass ich mir beim Schwimmen in die Badehose pinkelte und spürte, wie der warme Urin über die Innenseite meiner Oberschenkel glitt. Selbst als ich den Quallen entkommen war und mich zu meinen Highschool-Freunden am Lagerfeuer gesellt hatte, wo ich mit einer kühlen Flasche Jax in der Hand den Funken des Feuers dabei zusah, wie sie in einen türkisfarbenen Himmel aufstiegen, konnte ich das hartnäckige Gefühl von Angst und Schrecken nicht abschütteln, das wie glühende Kohlen in meinem Magen brannte.
Über meine Familie und das Leben bei uns zu Hause sprach ich so gut wie nie mit meinen Freunden. Meine Mutter konsultierte regelmäßig Wahrsager, belauschte die Telefongespräche der Nachbarn über den Gemeinschaftsanschluss und hatte mir als Kind ohne Unterlass Einläufe verabreicht. Sie verriegelte die Türen, hielt die Jalousien geschlossen und wetterte oft gegen den Alkohol und dessen Wirkung auf meinen Vater. Theatralik, Depression und tief empfundener Gram waren ihre ständigen Begleiter. Gelegentlich sah ich einen warnenden Ausdruck in den Augen unserer Nachbarn aufblitzen, wenn meine Eltern in einem Gespräch erwähnt wurden, und dann wirkte es stets, als würden sie mich davor beschützen wollen, die ganze Wahrheit über mein Zuhause zu erfahren. In diesen Momenten empfand ich Scham, Schuld und Wut, ohne genau zu wissen, warum. Dann saß ich in meinem Zimmer und hätte am liebsten etwas Hartes und Schweres in der Hand gehalten, aber ich wusste nicht, was. Mein Onkel Cody war ein Geschäftspartner von Frankie Carbo, einem Mitglied von Murder Incorporated, und hatte mich mal Benjamin »Bugsy« Siegel vorgestellt, als dieser mit Virginia Hill im Shamrock Hotel logierte. Manchmal dachte ich über diese Gangster nach – sinnierte über das Selbstvertrauen in ihren Gesichtern und die Kälte in ihren Augen, wenn sie jemanden ansahen, den sie nicht leiden konnten – und fragte mich, wie ich mich wohl verhalten würde, wenn ich in ihre Haut schlüpfen und über ihre Macht verfügen könnte.
Der Tag, an dem ich unbeschadet durch die Quallen schwamm, ohne verletzt zu werden, war der Tag, der mein Leben für immer veränderte. Denn an diesem Tag betrat ich ein Land, das weder Flagge noch Grenzen hat; einen Ort, an dem man seine Schutzinstinkte und seine Vorsicht vergisst und sein Herz auf einem Steinaltar offenbart. Ich spreche von dem Moment, an dem man sich zum ersten Mal Hals über Kopf verliebt und nicht im Entferntesten daran denkt, dass einem das Herz gebrochen werden könnte.
Ihr Name war Valerie Epstein. Sie saß in einem pinkfarbenen Cabrio, einem dieser lang gezogenen Cadillacs, die man damals nur »Boat« nannte. Der Wagen parkte vor einem Drive-in mit neonfarbener Fassade, das sich in der Nähe des Strandes befand. Ihre Schultern waren nackt und von einem leichten Sonnenbrand überzogen. Ihr kastanienbraunes Haar war voll und dicht, frisch gewaschen, von goldenen Strähnen durchzogen und mit einem Bandana auf dem Kopf zusammengebunden, wie bei den Frauen, die während des Krieges in den Rüstungsbetrieben gearbeitet hatten. Sie aß Pommes frites mit den Fingern und hörte dem großen, gut aussehenden Burschen zu, der neben ihr auf dem Fahrersitz des Cadillacs saß. Sein Haar war leicht gegelt und sonnengebleicht, seine Haut blass und frei von Tätowierungen. Er trug eine dunkle Brille, obwohl die Sonne bereits zerschmolzen und tief im Himmel stand und der Tag sich abzukühlen begann. Er ließ eine Vierteldollarmünze über die Fingerknochen seiner linken Hand wandern, wie ein Zocker aus Las Vegas oder ein Mensch, der den einen oder anderen geheimnisvollen Trick draufhatte. Sein Name war Grady Harrelson. Er war zwei Jahre älter als ich und hatte die Highschool bereits abgeschlossen, was bedeutete, dass ich wusste, wer er war, wohingegen er keine Ahnung hatte, wer ich war. Grady hatte breite, knochige Schultern, wie ein Basketballspieler, und trug ein verwaschenes lilafarbenes T-Shirt, das an ihm jedoch irgendwie stylish aussah. In der Highschool war er zum bestaussehenden Jungen gewählt worden, und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Für jemanden wie mich war es ein Leichtes, einen Kerl wie Grady zu hassen.
Ich weiß nicht, warum ich überhaupt ausstieg. Ich war müde, mein Rücken fühlte sich steif an, unter meinem Hemd bedeckte eine trockene Schicht aus Sand und Salz meinen Körper, und ich hatte noch fünfzig Meilen nach Houston vor mir, da ich den Wagen vor Einbruch der Dunkelheit meinem Vater zurückbringen musste. Am Horizont glitzerte bereits der Abendstern in einem blauen Lichtstreifen. Ich hatte Valerie Epstein schon zweimal aus der Ferne gesehen, aber noch nie aus nächster Nähe. Vielleicht wertete ich die Tatsache, dass ich sicher durch einen Schwarm Quallen geschwommen war, unbewusst als eine Art Omen. Valerie Epstein war Junior an der Reagan Highschool in Nord-Houston, eine als Spitzenschülerin bekannte Elftklässlerin mit süßem Lächeln und toller Gesangsstimme. Selbst die Halbstarken mit den Pomadenfrisuren, die Ketten unter ihren Autositzen deponierten und mit Springmessern in ihren Hosentaschen durch die Gegend liefen, behandelten sie wie eine Adlige.
Setz dich wieder ins Auto, iss deinen Krabbenburger,...









