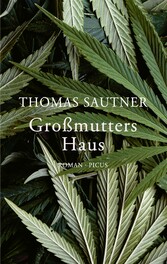
Großmutters Haus - Roman

von: Thomas Sautner
Picus, 2019
ISBN: 9783711753908
Sprache: Deutsch
252 Seiten, Download: 1169 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
- 6 -
»Der Schlitten gehört also deinem Freund.« Großmutter zuckte despektierlich mit einer Augenbraue. »Und dieser Freund ist verheiratet.«
Ich nickte, hob entschuldigend die Schultern.
»Und er hält dich seit Jahren hin, und jetzt willst du ihm endlich den Laufpass geben. Und bei der Gelegenheit den Mercedes zurückgeben.«
Erneut bestätigte ich mit einem Nicken.
»Aber wieso denn, Malina?!« Großmutter sah mich an, als wäre ich unzurechnungsfähig.
»Dein Freund, wie heißt er noch einmal?«
»Christian.«
»Ich bin sicher, der gute Christian ist dir unglaublich dankbar für all die Jahre … Freundschaft. Und er wäre untröstlich, könnte er dir nicht als Symbol seiner Freundschaft ein kleines Geschenk machen, und auch zum Dank dafür, dass du eure … Freundschaft nie gegenüber seiner Frau erwähnt hast.«
»Du schlägst vor, ich soll ihn erpressen?«
»Aber wo«, Großmutter wachelte mit der Hand, »nicht erpressen. Du schenkst ihm eine neue Freiheit. Männer mögen das. Und du schenkst ihm die Möglichkeit, dir für all die Jahre zu danken und einen sauberen Schlussstrich zu ziehen. Auch das mögen Männer, eine überschaubare, simple Lösung. Und wie sieht die in eurem Fall aus? Ganz klar: Christians Augensternchen kriegt ein Mercedessternchen.« Großmutter zog an ihrer Selbstgedrehten und blickte zufrieden Richtung Blumengarten.
Ich hatte ihr alles erzählt. Wobei, eigentlich hatte ich ihr überhaupt nicht alles erzählt, sie aber hatte auf der Stelle alles verstanden. Flugs waren wir vom Mercedes auf Christian gekommen, meine Nichtbeziehung zu ihm, mein ewiges Singledasein, die kleine Wohnung, die Arbeit in der Bücherei, alles in allem mein Einsiedlerinnenleben. Gut, ich traf Leute, ging hin und wieder aus, durfte sogar zwei liebe Menschen meine Freundinnen nennen; und dennoch, im Grunde lebte ich ein Einsiedlerinnenleben. Niemals bekam jemand einen unmittelbaren, mich und meine Wesensart erschließenden Zugang, und am schwersten wog wohl: selbst ich nicht. Stets schien sich das Entscheidende zu entziehen, verbarg sich das mich Ausmachende. Bis vor Kurzem hatte ich gedacht, ich sei alleine damit. Doch wieder einmal half die Literatur. Georg Büchner, »Dantons Tod«. Hier erfuhr ich aus fremdem Mund – welch ein Trost –, was ich längst vermutete: Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden; es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür. Ich auch nicht, aber ich vermute, dieser Makel, diese Unfähigkeit, den Kern unseres Wesens zu erkennen, beschäftigt uns ein Leben lang, zwingt uns, Mensch zu sein.
Andere scheint derlei nicht sonderlich zu beschäftigen. Gewiss, manches Mal zweifeln sie an sich, zweifeln und verzweifeln an der Menschheit, an unserer Zivilisation, unseren Verhältnissen. »Kann das denn wahr sein?«, fragen die Menschen, doch nie ist dieses »Kann das denn wahr sein?« buchstäblich gemeint. Ich hingegen meine es buchstäblich, stelle unser aller Existenz infrage samt Physik, Mathematik, Biologie, Geologie, Kosmologie. Zualleroberst aber stelle ich mich infrage.
Begonnen hatte es schon als Kind. Von Beginn meines erinnerten Denkens an fühlte ich mich wie auf eine Bühne gestellt, auf der ich mich nicht zurechtfand. Die mir zugedachte Rolle schien mir unpassend und auch die gesamte Bühne dubios, obgleich alle, wirklich alle anderen ernsthaft behaupteten, diese unsere Rollen und diese unsere Bühne seien das einzige Leben und die einzige Welt.
Sobald ich aber auch nur einen eingehenden Blick darauf richtete, war doch der Vorhang zu erkennen, der alles verbarg, die Kostüme, der billige Klamauk. Und mit dem zweiten Blick sah ich auch das Dahinter, das Rundherum und also die Bühne samt uns darauf wie frei und luzid schweben in einem ewiglich dunklen All. Nur eines sah ich nicht, die heimtückische Macht, die uns alle auf diese Bühne platziert, uns Rollen zugeteilt und dafür gesorgt hatte, dass wir so fest daran glaubten, als wäre es das Ein und Alles. Hatte dieses Schauspiel irgendeinen Sinn? Beobachtete es jemand, abgesehen von uns selbst? Woher kam die Idee dazu? Wohin würde sie uns führen?
»Mach dir nicht so schwere Gedanken«, hatte eine freundliche Frau in der Klinik zu mir gesagt. »Du bist noch so jung, lebe das Leben.« Ich erinnere mich gut an sie. Sie hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit der Rotwangigen von der Post. Gerne wäre ich damals ihrem Rat gefolgt, doch ich misstraute ihr. Wusste sie mehr, als sie vorgab? Wollte sie mich in die Irre führen?
»Die Herausforderung bei existenziellen philosophischen Fragen ist, nicht daran verrückt zu werden.« Auch dieser Satz fiel damals in der Psychiatrie, jemand sagte ihn so nebenbei dahin. Der Satz leuchtete mir ein. Meine Sorge etwa, dass alle Menschen unter einer Decke stecken könnten und ich womöglich die einzige Uneingeweihte war, diese mich irremachende Wahnvorstellung musste ich schleunigst loswerden.
Vom Philosophie-Studium erhoffte ich mir, etwas Klarheit in derlei Unwägbarkeiten zu bekommen. Ich ließ keine Vorlesung aus, die sich auch nur annähernd den Themen Einbildung und Wirklichkeit widmete. Buddha zum Beispiel. Als der sich von seinem schattigen Plätzchen unterm Feigenbaum erhob und verblüfft feststellte, dass er nun alles wisse, war er da ein Weiser oder ein Narr? In seiner Erleuchtung hatte er die Leere der Dinge erkannt und dass dem Sein die Wirklichkeit abgesprochen werden müsse. Daran verzweifelte er aber nicht, sondern begegnete dem Nichts der Welt mit amüsierter Gelassenheit und ließ sich ein ansehnliches Bäuchlein wachsen, der Leere der Dinge zum Trotz.
Welcher Widerspruch zu Descartes, dem Oberschlauen unter den Philosophen. Ich denke, also bin ich. Als ob Denken ein Beweis wäre! Als ob es auch nur irgendeinem Wesen möglich wäre, zu erkennen, ob sein Denken in Bezug zu einer größeren Realität als der eigenen steht!
Ich denke, also bin ich. Jedes bessere Tamagotchi kann sich das einreden! Origineller als Descartes war da schon Augustinus von Thagaste mit seinem Wenn ich mich täusche, bin ich. Wäre er nicht, dachte Augustinus, könnte er sich auch nicht täuschen. Nun, wer weiß. Mittlerweile steht schließlich schon auf T-Shirts, Glaub nicht alles, was du denkst.
Fragwürdig ist mir auch die Naturwissenschaft, obwohl sie heute eine uns disziplinierende Autorität genießt, wie einst seine Heiligkeit, der unfehlbare Papst. Der Satz des Pythagoras etwa, die Erkenntnisse von Kopernikus und Galilei oder Newtons Gravitationsgesetz. Ich bezweifle die Allgemeingültigkeit jener und aller anderen wissenschaftlichen Beweise. Selbst Einstein, dem der Welt die Zunge zeigenden Magier unter den Wissenschaftern, misstraue ich, ihm, der den Zaubertrick zuwege brachte, Energie, Masse und Zeit ihre Absolutheit zu nehmen, indem er sie verschmolz, dem auch das Kunststück gelang, die Relativität von Zeit und Raum darzulegen. Großartig, aber welcher Zeit? Und welchen Raumes? Jenem in der größtmöglichen Wirklichkeit? Oder womöglich ja doch nur jenem unseres gedanklichen Universums?
All die Genies nämlich, all die Einsteins, Galileis und Newtons, finde ich dahergelaufenes Landei, schummeln sich über eine entscheidende Kleinigkeit hinweg: uns.
Sie alle gehen, so fabelhaft ihre Ideen sind, von einer unbewiesenen Prämisse aus: dass wir Menschen real sind.
Sind wir es nicht, befindet sich womöglich alles, was wir Materie, Raum und Zeit nennen, was wir Sonne, Mond und Sterne heißen, lediglich in unserem die Dinge träumenden Geist. Und die andere Wirklichkeit, jene, die weit darüber hinaus besteht, ist uns gänzlich fremd.
War ich deshalb auf die Literatur gekommen? Weil sie eine Brücke aus unserer Enge beschrieb? Weil ihre Offenheit mir glaubwürdiger schien? Wahrer als die Wahrheit, wie Hemingway sagte?
Mitunter ertappe ich mich dabei, selbstvergessen dieses alte englische Kinderlied zu summen:
Row, row, row your boat,
gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
life is but a dream.
Und dann ist mir auch noch der Größenwahn eigen, dass ich denke, wenn ich mich nur konsequent jener uns verborgenen Wirklichkeit hingebe, erwache ich wahrhaft aus diesem Kindertraum, in dem wir Menschen seit Anbeginn schlafwandeln.
Als brächte es mich weiter, stelle ich mich manchmal nahe zur Wand, nahe, ganz nahe an den dort hängenden Spiegel, und springe in meine Augen. Falle durch sie ein in mich. Widerstehe dem Schrecken, widerstehe dem Fluchtreflex, versuche vorzudringen. Doch sosehr ich auch forsche, bis ganz hinab, bis auf meinen Grund komme ich nie. Wohin ich immerhin komme, sind Augenblicke des Sehens, einmal mich schaudernd, einmal mich beglückend. Wohin ich...









