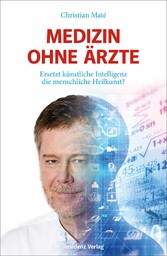
Medizin ohne Ärzte - Ersetzt künstliche Intelligenz die menschliche Heilkunst?

von: Christian Maté
Residenz Verlag, 2020
ISBN: 9783701746385
Sprache: Deutsch
176 Seiten, Download: 306 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Kapitel 1:
Gut versorgte Patienten leben länger
Drei Wünsche an den AI-Doktor
Als Ende der 1990er-Jahre die ersten europäischen Gesundheitsportale, unbestreitbar inspiriert von ihren US-amerikanischen Vorbildern, gelauncht wurden, war die Aufregung in den medizinischen Communities groß. Vor allem innerhalb der Ärzteschaft wurde allen Ernstes die Frage diskutiert, ob eine derart weitgehende medizinische Information für Laien überhaupt zulässig sei oder ob sie nicht vielmehr eine systematische Sabotage des impliziten Behandlungsvertrages zwischen Arzt und Patient bedeute. Als Chefredakteur und späterer Co-Eigentümer der österreichischen Tochter des dänischen Start-ups netdoktor wurde ich in Interviews vor allem gefragt, ob der Besuch eines Gesundheitsportals den Arztbesuch ersetzen könne beziehungsweise solle. Ich war stets froh, dass ich diese Frage aus ganzem Herzen verneinen konnte und nicht in diplomatisches Geschwurbel ausweichen musste. netdoktor und die anderen medizinischen Internetangebote für Laien und Patienten wurden tatsächlich als komplementäre Services zum Arztbesuch gegründet. Vorab informierte Patienten – so die Hypothese – können den Arzt besser verstehen und trauen sich eher Fragen zu stellen. »Patienten, die viel fragen, sind äußerst lästig«, hat ein großer österreichischer Mediziner einmal in seiner Vorlesung gesagt und dann hinzugefügt: »Aber sie leben länger.« Das bringt es auf den Punkt: Durch fachlich korrekte und für Laien verständliche Informationen zu Krankheiten, Untersuchungen und Therapien werden die Patienten in der Beziehung zum Arzt gestärkt, sie werden fordernder, in vielen Fällen mühsamer, aber eben auch gleichberechtigter in ihrer Verantwortung für die eigene Gesundheit.
Natürlich beschränkt sich der Nutzen von leicht verfügbaren, allgemein verständlichen Gesundheitsinformationen nicht auf den Arztbesuch selbst. Studien zeigen, dass Patienten 40 bis 80 Prozent der Informationen des Arztes beim Verlassen der Praxis bereits wieder vergessen haben. Das liegt vor allem daran, dass sie sich auf die Diagnose konzentrieren und darauf, was diese für ihr weiteres Leben bedeutet. Die Informationen des Arztes betreffen hingegen meist die Therapie und die ist nicht so stark emotional besetzt. Jedenfalls bieten Gesundheitsportale den Patienten die Möglichkeit, wesentliche Informationen zu ihrer Erkrankung und zur vom Arzt verordneten Therapie nach dem Arztbesuch nachzulesen – ein Umstand, der nachweislich einen Beitrag zur sogenannten Adhärenz leistet, also zur Fähigkeit und Motivation, die Therapie in der vom Arzt beabsichtigten Form anzuwenden.
Damals, im Pleistozän des Internets, hieß Digital Healthcare noch »e-Health« und von einer Medizin ohne Ärzte war natürlich keine Rede. Zu weit weg waren die damals verfügbaren Angebote von den eigentlichen Prozessen des Gesundheitswesens, für die die bloße Bereitstellung von Informationen lediglich die Baseline zur eigentlichen Melodie darstellte: dem Erheben von Befunden in den Arztpraxen, Labors und Röntgeninstituten, der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker beim Einsatz von Medikamenten, den manuellen und zum Teil invasiven Interventionen auf den Behandlungstischen und in den Operationssälen.
Das hat sich nun fundamental geändert. Die lernenden Programme, die unter dem vielversprechenden und sympathisch unpräzisen Label »Artificial Intelligence« (AI) in so gut wie alle Branchen hineindiffundieren, sind gerade dabei, sich als echte Gamechanger im Gesundheitswesen zu etablieren. Lassen wir einmal die AI-unterstützte Erfassung unstrukturierter Daten und die Kommunikation im Sinne von Assistenzsystemen außer Acht und konzentrieren wir uns auf die drei Schlüsselthemen im Gesundheitswesen: Diagnostik, Therapie und Versorgung.
Bessere Diagnostik – Krankes früher erkennen
In seinem 1910 uraufgeführten Theaterstück »Anatol« lässt Arthur Schnitzler, im Zweitberuf Arzt, seine Hauptfigur sagen: »Es gibt so viele Krankheiten und nur eine Gesundheit –! … Man muss immer genau so gesund wie die andern – man kann aber ganz anders krank sein wie jeder andere!« Der Gedanke hat zweifellos etwas, aber die meisten Patienten betrachten ihre Erkrankung weniger als Ausdruck ihrer Individualität denn als Zustand, den es so rasch wie möglich zu beenden gilt. Und dabei kann die Vielfalt durchaus hinderlich sein. Die moderne Krankheitslehre, systematisch erfasst und kategorisiert im sogenannten ICD, der International Classification of Diseases, kennt in seiner ab 2022 gültigen Version, dem ICD-11, mehr als 55 000 verschiedene Arten, nicht gesund zu sein. Dazu zählen sogenannte Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Asthma am einen Ende des Spektrums und sogenannte seltene Erkrankungen, also Krankheiten, von denen nur ein geringer Anteil der Bevölkerung betroffen ist, am anderen Ende. Knapp über zehn Prozent aller im ICD-10 erfassten Krankheitsbilder fallen in die Kategorie »selten«. Als selten gelten in Europa Erkrankungen, an denen nicht mehr als eine von 2000 Personen leidet. Zu den bekanntesten seltenen Erkrankungen zählen etwa die Hämophilie, eine angeborene Gerinnungsstörung des Blutes, die cystische Fibrose, bei der zäher Schleim Lunge und andere Organe verstopft, oder die auch als Glasknochenkrankheit bezeichnete Osteogenesis imperfecta.
Von der idiopathischen Lungenfibrose etwa, einer Krankheit, bei der es zur schrittweisen Vernarbung der Lunge und damit zu fortschreitender Atemnot kommt, sind 65 bis 90 von 100 000 Menschen betroffen. Eines der Probleme in der Diagnostik dieser seltenen Erkrankung ist der Umstand, dass sie ganz ähnliche Beschwerden hervorruft wie die wesentlich häufigere, zu den Volkskrankheiten zählende COPD, also Atemnot, chronischen Husten und Müdigkeit. In der Lunge spielen sich allerdings zwei ganz unterschiedliche Prozesse ab. Im Fall der COPD kommt es – meist als Folge chronischen Tabakkonsums – zu einer fortschreitenden Verengung der Bronchien, was zwar nicht umkehrbar, aber doch über weite Strecken symptomatisch einigermaßen gut behandelbar ist. Anders verhält es sich mit der idiopathischen Lungenfibrose, der IPF. Bei dieser erblichen Erkrankung kommt es zu einer bindegewebigen Vernarbung und Versteifung der gesamten Lunge, ein Prozess, der bis vor einigen Jahren therapeutisch überhaupt nicht positiv beeinflussbar war. Mittlerweile sind zwei Medikamente für die Behandlung der IPF zugelassen. Beide haben in Studien gezeigt, dass sie das Fortschreiten der Erkrankung zwar nicht stoppen, aber doch verlangsamen können. Es liegt auf der Hand, dass ein möglichst früher Einsatz den Patienten Lebensqualität und Lebensjahre schenken kann. Denn ist erst einmal ein großer Anteil des Lungengewebes durch Bindegewebe ersetzt, bleibt häufig nur die Transplantation einer Spenderlunge als letzter Ausweg.
Was das alles mit den Cyberdocs der Zukunft zu tun hat? Nun, Studien zeigen, dass die Diagnose einer idiopathischen Lungenfibrose im Schnitt mit einer Verzögerung von 2,1 Jahren gestellt wird. Zum Teil liegt das Problem dabei auf der Seite der Patienten, die erst verspätet zum Arzt gehen, ein wesentlicher Teil fällt jedoch in die Sphäre des Arztes, der die Symptome und die Untersuchungsergebnisse nicht richtig interpretiert. Weder dem Hausarzt, der so einen Patienten jahrelang immer wieder aus verschiedenen Gründen in der Praxis hat, noch dem Lungenfacharzt, der ihn ebenso lange als COPD-Patient behandelt, ist dabei ein Vorwurf zu machen. Kein Gehirn der Welt kann sich die Symptome samt Häufigkeiten von Tausenden Erkrankungen merken. Im Medizinstudium und auch später in der praktisch-klinischen Ausbildung lernen Ärzte eine wenig originelle, aber logisch unantastbare Regel: Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Mögen exotische Erkrankungen auch noch so drollige und leicht merkbare Namen oder anspruchsvolle Krankheitsmechanismen haben – die diagnostische Wahrheit ist eben in den meisten Fällen recht banal und hat mit dem Flipchart von Dr. House wenig zu tun. Wenn man Hufgetrampel hört, lautet der zweite Merksatz für den aufstrebenden Diagnostiker, so handelt es sich zumindest in unseren Breiten sehr wahrscheinlich um Pferde und nicht um Zebras, ganz gleich, wie schick und aufregend es wäre, Letzteren einmal zu begegnen.
Dennoch: Zählt man die Betroffenen aller seltenen Erkrankungen zusammen, so erhält man eine wahrlich gewaltige Herde von Zebras, und das bedeutet verzögerte Diagnosen in vielen Millionen von Fällen. Und hier kommen die Maschinen ins Spiel: Tatsächlich gibt es schon seit Längerem medizinische Expertensysteme. Das sind mehr oder weniger komplexe Softwareprogramme, die, vollgestopft mit diagnostischen Algorithmen, dem kognitiv überforderten Arzt zur Seite stehen – theoretisch. In der Praxis konnten diese Programme nie so richtig durchstarten. Bereits 1972 wurde an der Harford University zum Beispiel ein sehr treffsicheres Programm namens MYCIN für die Diagnostik und Therapie von Infektionskrankheiten entwickelt. In der Praxis zündeten MYCIN und andere klassische Expertensysteme...









