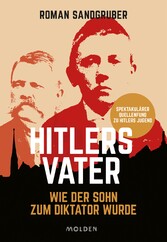
Hitlers Vater - Wie der Sohn zum Diktator wurde
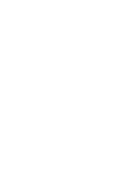
von: Roman Sandgruber
Molden Verlag , 2021
ISBN: 9783990406182
Sprache: Deutsch
272 Seiten, Download: 12770 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Das Dasein, als Zöllner zu leben
Für Ziehkinder gab es selten einen dauerhaften Platz im Haus der Zieheltern. Für Alois blieb nach dem Ende der Schulpflicht daher nur die Wahl, zu anderen Bauern in Dienst zu gehen oder sich eine Existenz außerhalb der Landwirtschaft zu suchen: im Handwerk, als Taglöhner, Fabrikarbeiter, Soldat oder Auswanderer. Mit dreizehn Jahren, im Jahr 1850, begann er daher bei dem Spitaler Schuhmachermeister Anton Ledermüller aus der Weitraer Schusterzunft eine Lehre. Eine wirklich qualifizierte Ausbildung war das wahrscheinlich nicht. Sie war ja mit zwei Jahren auch nur sehr kurz. Sehr anspruchsvoll waren weder das Schuhwerk, das damals im Waldviertel getragen wurde, noch die Ausbildung, die für seine Erzeugung erforderlich war: Holzschuhe, Holzbundschuhe und die üblichen Ausbesserungsarbeiten – eine Flickschusterei eben. Nach einem Probejahr erfolgte am 19. März 1851 die Aufdingung, also die fixe Aufnahme als Lehrling. Der entsprechende Eintrag im Zunftbuch lautet: »Lässt Anton Ledermüller von Spital den Alois Schicklgruber von Döllersheim aufdingen und zahlt 1 fl 20 kr. nach 1 Probejahr.« Am 28. März 1852 war bereits die Freisprechung zum Gesellen erreicht: »Lässt Anton Ledermüller von Spital seinen Lehrjungen Alois Schicklgruber von Döllersheim freisprechen und zahlt 1 fl 30 kr.«57
Zöllner und Schmuggler im Pinzgau
Recht merkwürdig ist, was Adolf Hitler in einem seiner Monologe im Führerhauptquartier im Jahr 1941 daherredete: »Im alten Österreich gab es zwei Berufsgruppen, für die man mit Vorliebe Vorbestrafte wählte: die Zöllner und die Förster. Zu den Zöllnern nahm man Schmuggler, meist solche, die vor der Wahl standen, Zuchthaus zu bekommen oder in den Staatsdienst zu gehen; zu Förstern machte man Wilderer. Beide, Schmuggler und Wilderer, treibt die Leidenschaft, es liegt ihnen im Blut. Wenn einer so einen romantischen Komplex hat, dann muss man ihm Gelegenheit geben, ihn abzureagieren …«59
Eine Respektsperson mit Wohlstandsbäuchlein und blinkenden Knöpfen: k.k. Zollamtsoberoffizial Alois Hitler in seiner Ausgehuniform. In seiner Bartmode folgte er dem 45 Kaiser.
Alle haben sich beteiligt, auch die Zollbeamten. Arm waren sie ja alle und alle brauchten sie Geld. Notwendig waren Zähigkeit und Mut. Geschmuggelt wurde alles, was es hüben oder drüben nicht gab oder was billiger zu haben war: Pfeifentabak und Zigarren, Zucker und Kaffee, Speck und Butter, Alkohol und Salz, Textilien und Eisenwaren, lebende Hühner und Gänse, aber auch ausgewachsene Rinder und Pferde. Gesucht wurde natürlich auch nach staatsgefährdenden oder pornografischen Schriften und nach gefährlichen Revolutionären und flüchtigen Kleinkriminellen. Gearbeitet wurde mit allen erdenklichen Tricks, um über die Grenze zu kommen, am besten in mondlosen Nächten, bei Nebel und Regen, einzeln oder in ganzen Banden, auf damals wie heute gefährlichen Steigen und Schleichwegen. Vor allem das Salz war der Stein des Anstoßes: »Bayern, welches einen sehr großen Theil des Salzes, das wir an den Grenzen zu speisen bekommen, durch den Schmuggel zu uns herüberschafft, verkauft sein Salz zu 4 und 5 fl per Zentner, bei uns beträgt der Preis des Salzes 8, 10, auch 11 fl.«, klagte der Abgeordnete Ignaz Mayer 1868 im Wiener Reichsrat.60
Doch plötzlich kracht Musketen Knall
Dem Schmugglervolk entgegen.
»Ergebet Euch!« so ruft es her –
doch nein – man greift zur Gegenwehr …«65
Die romantische Rede von den Sozialrebellen ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn das Alltagsgeschäft an der Grenze bestand in penibler und bürokratischer Kontrolle. Kontrolliert wurden nicht nur die Kaufleute, die wenigen Touristen und der tägliche kleine Grenzverkehr, sondern vor allem viel fahrendes Volk: »Zigeuner«, Wanderhändler und Hausierer, unter denen sich auch Juden befanden oder zumindest vermutet wurden. Man fahndete nach Kriminellen und Revolutionären, nach Betrügern und Staatsfeinden und nach aufrührerischen, kirchenkritischen Büchern und Pornografie. Das erklärt auch, warum sich im Zoll eine spezifische Subkultur herausbildete, in der die Abneigung gegen Randgruppen, Minderheiten und Juden besonders groß wurde. Antisemitismus hatte im Zoll eine besondere Tradition. Das war auf der Führungsebene beim Leiter der Wiener Zollbehörde Franz Holzer, der sich von ganz unten hinaufgedient hatte, nicht anders als bei den untergeordneten Chargen. Man muss daher auch bei Alois Hitler, obwohl das nie ausgesprochen wurde, mit einer entsprechenden antisemitischen und minderheitenfeindlichen Grundhaltung rechnen.
Mythos Braunau
»In Braunau, diesem von den Strahlen deutschen Märtyrertums vergoldeten Innstädtchen, bayerisch dem Blute, österreichisch dem Staate nach, wohnten am Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts meine Eltern; der Vater als pflichtgetreuer Staatsbeamter, die Mutter im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan …«, schreibt Adolf Hitler in den ersten Sätzen von Mein Kampf.72 Er, der nur die ersten drei Jahre seines Lebens in Braunau verbracht hatte, konnte daran kaum eine Erinnerung haben. Und auch für seinen Vater waren die einundzwanzig Braunauer Jahre sicherlich nicht nur reine Freude: Als Auswärtiger, als Zollbeamter und als Vertreter des österreichischen Staates war er in der Grenzstadt nicht unbedingt willkommen. Einfach war es für Fremde im Innviertel selten: Der Innviertler sei stolz, hochfahrend und verschlossen, trinkfreudig und rauflustig sowie revolutionär gegen alle höheren Verordnungen, mögen sie nun aus Linz oder aus Wien kommen, meinte der bekannte Volkskundler Eduard Kriechbaum, der aus dem Mühlviertel stammte und von 1913 bis 1939 Ranshofener und Braunauer Stadtarzt war und die Innviertler Mentalität wie kein anderer kannte.73
Adolf lebte hier nur einige Monate: das Hitler-Geburtshaus in Braunau am Inn, Vorstadt 219, damals der »Gasthof zum Braunen Hirschen« (links).
Der Dienstort des Vaters: die kaiserliche Zollstation erster Klasser am Bahnhof Simbach. Auf- und Grundriss des Hauptgebäudes (Mitte).
Loyal zu Kaiser und Monarchie und doch gleichzeitig deutschnational und pangermanisch denkend: die Linzer Zoll- und Verzehrungssteuerbeamten, um 1914 (unten).
Für Alois war in Braunau der beschwerliche und gefährliche Außendienst vorbei. Die erhaltenen Fotos bestätigen eine stattliche äußere Erscheinung, mit einem im 19. Jahrhundert durchaus noch geschätzten Wohlstandsbäuchlein, mit blinkenden Knöpfen, goldfarbener Bauchbinde, Säbel und Zweispitz. Seine Bartmode folgte der des Kaisers. Seine Karriere war ja wirklich beachtlich: Nur mit einfachster Pflichtschulbildung hatte er den Sprung vom reinen Wachdienst zum Beamtenstatus geschafft, zuerst als Amtsassistent, dann Kontrolleur, schließlich Zollamtsoffizial, zuletzt Oberoffizial. Alois war in der Mittelschicht angekommen. 1876 schrieb er voll Stolz an eine Verwandte in Niederösterreich: »Seit Du mich vor 16 Jahren zum letzten Mal gesehen hast, als ich ein Finanzwach-Oberaufseher war, bin ich sehr weit aufgestiegen und habe bereits zwölf Jahre als Beamter im Zollwesen gedient.« An das Ende dieses um Eindruck heischenden Briefs setzte er seine Adresse: »Beamter in der kaiserlichen Zollstation erster Klasse am Bahnhof Simbach, Bayern, Adresse Braunau, Linzerstraße.«76
Schicksalsschläge und Ehestrategien
Ob die sorgenvollen Worte, die Alois, nunmehr Hitler, 1876 über den Gesundheitszustand seiner Frau Anna verfasste, von Herzen kamen, weiß man nicht. Jedenfalls schrieb er am 17. September 1876 an eine Verwandte über seine Frau: »Unglücklicher Weise leidet sie seit langer Zeit an einer Brustschwäche und braucht sehr viel Umsorgung. Gäbe es nicht das gute Klima hier in Braunau, würde es ihr nie gut gehen. Es ist nur meine Stellung, Gott sei Dank, die mir erlaubt, ihr Leben von Leiden frei zu machen.«86 Ob die Ehe damals schon schlecht...









