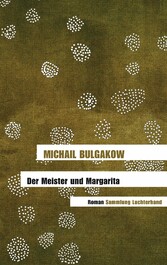
Der Meister und Margarita - Roman

von: Michail Bulgakow
Luchterhand Literaturverlag, 2012
ISBN: 9783641029913
Sprache: Deutsch
496 Seiten, Download: 1902 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1 Sprechen Sie nie mit Unbekannten
An einem ungewöhnlich heißen Frühlingstag erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Moskauer Patriarchenteichboulevard zwei Männer. Der eine, etwa vierzig Jahre alt, trug einen mausgrauen Sommeranzug, war von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, wohlgenährt und hatte eine Glatze; seinen gediegenen Hut, der wie ein Brötchen aussah, hielt er in der Hand, und das glattrasierte Gesicht war mit einer überdimensionalen schwarzen Hornbrille geschmückt. Der andere, ein breitschultriger junger Mann mit wirbligem rötlichem Haar, hatte die gewürfelte Sportmütze in den Nacken geschoben und trug ein kariertes Hemd, zerknautschte weiße Hosen und schwarze Turnschuhe.
Der erste war niemand anders als Michail Alexandrowitsch Berlioz, Chefredakteur einer dickleibigen Literaturzeitschrift und Vorsitzender einer der größten Moskauer Literatenassoziationen, abgekürzt MASSOLIT; sein junger Begleiter war der Lyriker Iwan Nikolajewitsch Ponyrew, der unter dem Pseudonym »Besdomny« schrieb.
Nachdem die beiden Schriftsteller den Schatten der grünknospenden Linden erreicht hatten, stürzten sie sich als erstes auf ein buntgestrichenes Büdchen mit der Aufschrift »Bier und div. Mineralwasser«.
Es ist nun an der Zeit, die erste Merkwürdigkeit dieses entsetzlichen Maiabends zu erwähnen. Nicht nur bei dem Büdchen, nein, in der ganzen Allee, die parallel zur Kleinen Bronnaja-Straße lief, war keine Menschenseele zu sehen. In einer Stunde, in der wohl keiner mehr die drückende Luft atmen mochte und die Sonne, nachdem sie Moskau durchgeglüht hatte, im trockenen Dunst irgendwo hinterm Sadowoje-Ring wegsackte, kam niemand unter die Linden, saß niemand auf den Bänken, und die Allee war menschenleer.
»Narsan bitte«, sagte Berlioz.
»Ham wir nicht«, antwortete die Frau im Büdchen und war komischerweise beleidigt.
»Haben Sie Bier?« fragte Besdomny heiser.
»Bier kommt erst noch«, antwortete die Frau.
»Was haben Sie denn da?« fragte Berlioz.
»Aprikosenlimonade, aber die ist warm«, sagte die Frau.
»Na los, geben Sie her, geben Sie her!«
Die Aprikosenlimonade warf reichlichen gelben Schaum, und in der Luft verbreitete sich Friseurladengeruch. Als die beiden Schriftsteller ausgetrunken hatten, bekamen sie den Schluckauf; sie zahlten und setzten sich auf eine Bank, das Gesicht dem Teich, den Rücken der Kleinen Bronnaja-Straße zugekehrt.
In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit; sie betraf jedoch nur Berlioz. Er hörte plötzlich auf zu schlucken, sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment, dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin. Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt, daß er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre.
Wehmütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte. Er erblaßte, wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn und dachte: Was hab ich bloß? So was kenne ich doch gar nicht. Das Herz macht Dummheiten … Ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich alles stehn- und liegenlassen und nach Kislowodsk abhauen …
Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühendheiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen. Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockeymütze, und er trug ein fipsiges, luftiges kariertes Jäckchen. Er war über zwei Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager, und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies.
Berlioz’ Leben war bislang so verlaufen, daß er absonderliche Erscheinungen nicht gewohnt war. Er wurde noch käsiger, riß die Augen weit auf und dachte bestürzt: Das kann doch nicht wahr sein!
Doch o weh, es stimmte, und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her.
Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, daß er die Augen zukniff. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei – das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen.
»Den Deibel auch!« rief der Redakteur aus. »Weißt du, Iwan, ich hätte doch eben beinah den Hitzschlag gekriegt! Sogar eine Art Halluzination hab ich gehabt …« Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe, und seine Hände flatterten. Allmählich aber beruhigte er sich, wedelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu, sagte ziemlich munter: »Also weiter …« und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren.
Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus. Die Sache war die, daß der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte. Besdomny hatte das Poem verfertigt, und das in sehr kurzer Zeit, doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteur in keiner Weise zufrieden. Der Lyriker hatte die Hauptperson, Jesus also, in sehr schwarzen Farben gemalt, doch nichtsdestoweniger mußte nach Meinung des Redakteurs das Poem völlig neu geschrieben werden. Jetzt hielt er dem Poeten eine Art Vorlesung über Jesus, um ihm seinen Grundfehler zu verdeutlichen.
Schwer zu sagen, was Besdomny in die Irre geführt hatte, die Gestaltungskraft seines Talents oder seine völlige Unkenntnis des Stoffs, über den er schrieb, jedenfalls war Jesus bei ihm sehr lebendig geraten, wenn auch alles andere als sympathisch.
Berlioz wollte nun dem Lyriker beweisen, daß es gar nicht darum ging, ob Jesus schlecht oder gut gewesen sei, sondern darum, daß er als Persönlichkeit nie existiert hatte und daß alle Erzählungen über ihn schlicht Erfindungen, gewöhnliche Mythen seien.
Es sei eingeflochten, daß der Redakteur ein belesener Mann war und in seinen Ausführungen sehr geschickt auf antike Chronisten verwies, wie zum Beispiel den berühmten Philo von Alexandrien und den glänzend gebildeten Josephus Flavius, die beide die Existenz Jesu mit keinem Wort erwähnt hätten. Solide Gelehrsamkeit bekundend, teilte er dem Lyriker unter anderm mit, daß die Stelle im fünfzehnten Buch, 44. Kapitel der berühmten »Annalen« von Tacitus, wo von der Hinrichtung Jesu die Rede ist, nichts anderes sei als eine viel später eingeschobene Fälschung.
Der Lyriker, dem all das neu war, hörte Berlioz aufmerksam zu und blickte ihn dabei mit seinen flinken grünen Augen an; nur ab und zu, wenn ihn der Schluckauf beutelte, schmähte er flüsternd die Aprikosenlimonade.
»Es gibt keine einzige östliche Religion«, sagte Berlioz, »in der nicht eine unbefleckte Jungfrau einen Gott zur Welt gebracht hätte. Die Christen haben sich gar nichts Neues ausgedacht, sondern ihren Jesus, der in Wirklichkeit nie gelebt hat, genauso geschaffen. In dieser Richtung mußt du den Hauptstoß führen.« Berlioz’ hoher Tenor schallte durch die leere Allee, und je weiter er in das Gestrüpp eindrang, in das nur ein vorzüglich gebildeter Mensch eindringen kann, ohne sich den Hals zu brechen, desto mehr Reizvolles und Nützliches erfuhr der Lyriker über den ägyptischen Osiris, gnädigen Gott und Sohn Himmels und der Erden, und über den phönizischen Gott Tammus und über Marduk und sogar über den weniger bekannten drohenden Gott Huitzilopochtli, den die alten Azteken in Mexiko einstmals sehr verehrt hätten.
Und als Berlioz dem Lyriker eben erzählte, die Azteken hätten Huitzilopochtli-Figürchen aus Teig geformt, da erschien in der Allee auf einmal ein Mann.
In der Folgezeit, als es, offen gestanden, längst zu spät war, legten verschiedene Behörden Berichte mit einer Beschreibung dieses Mannes vor. Ein Vergleich der Berichte bringt Erstaunliches zutage. So heißt es in dem einen Bericht, der Mann sei klein, habe Goldzähne und lahme auf dem rechten Fuß. Ein anderer Bericht besagt, der Mann sei riesengroß, habe Platinkronen und lahme auf dem linken Fuß. Ein dritter teilt lakonisch mit, der Mann habe keine besonderen Kennzeichen.
Es sei zugegeben, daß die Berichte samt und sonders nichts taugen.
Vor allem eines: Der Beschriebene lahmte überhaupt nicht und war weder klein noch riesig, sondern einfach groß. Was seine Zähne betrifft, so trug er links Platinkronen und rechts Goldkronen. Bekleidet war er mit einem teuren grauen Anzug und dazu passenden ausländischen Schuhen. Die graue Baskenmütze hatte er flott aufs Ohr geschoben, und unterm Arm trug er einen Stock mit schwarzem Knauf in Form eines Pudelkopfes. Dem Aussehen nach war er etwas über vierzig. Der Mund war leicht schief. Das Gesicht glattrasiert. Brünett. Das rechte Auge war schwarz, das linke aber grün. Die Brauen waren schwarz, doch saß die eine etwas höher als die andere.
Kurzum – ein Ausländer.
Als er an der Bank vorbeiging, auf der der Redakteur und der Lyriker saßen, warf er ihnen einen Seitenblick zu, blieb dann zwei Schritt weiter plötzlich stehen und setzte sich auf die Nachbarbank.
Ein Deutscher, dachte Berlioz.
Ein Engländer, dachte Besdomny, du lieber Gott, daß er nicht schwitzt mit den Handschuhen!
Der Ausländer ließ den Blick über die hohen Häuser gleiten, die den Teich quadratisch säumten, und es war zu erkennen, daß er diese Gegend zum erstenmal sah und daß sie ihn interessierte.
Sein Blick verweilte auf den oberen Etagen, deren Fenster blendend hell die für immer aus Berlioz’ Augen entschwindende Sonne reflektierten, dann glitt er tiefer, dahin, wo die Fenster schon abendlich dunkelten; der Mann lächelte nachsichtig, kniff die Augen ein, legte die Hände auf den Stockknauf und das Kinn auf die Hände.
»Du, Iwan, hast zum Beispiel die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, sehr schön und satirisch dargestellt«, sagte Berlioz, »aber das Pikante ist doch, daß vor Jesus...









