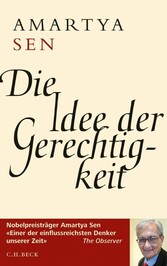
Die Idee der Gerechtigkeit
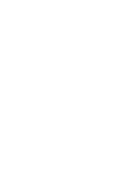
von: Amartya Sen
Verlag C.H.Beck, 2020
ISBN: 9783406616693
Sprache: Deutsch
495 Seiten, Download: 2943 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
VORWORT
«In der kleinen Welt, in der Kinder leben», sagt Pip in Charles Dickens’ Roman Große Erwartungen, «gibt es nichts, was sie so feinsinnig aufnehmen und empfinden wie Ungerechtigkeit.»[1] Pip wird wohl Recht haben: Nach seiner demütigenden Begegnung mit Estella erinnert er sich lebhaft an die «launenhaften und gewalttätigen Zwangsmaßnahmen», die er als Kind von der Hand seiner eigenen Schwester erdulden musste. Aber auch Erwachsene nehmen offenkundiges Unrecht deutlich wahr. Nicht die Erkenntnis, dass die Gerechtigkeit auf der Welt unvollkommen ist – vollkommene Gerechtigkeit erwarten nur wenige von uns –, treibt uns zum Handeln, sondern die Tatsache, dass es in unserer Umgebung Ungerechtigkeiten gibt, die sich ausräumen lassen und die wir beenden wollen.
Das ist greifbar genug in unserem täglichen Leben mit den Unbilligkeiten und Unterdrückungen, die uns zu schaffen machen und mit gutem Grund ärgern, aber es gilt auch für wahrgenommene Ungerechtigkeiten im weiteren Umkreis unserer Lebenswelt. Ohne einen Gerechtigkeitssinn, der ihnen sagte, dass manifeste Ungerechtigkeiten überwunden werden können, hätten die Pariser sehr wahrscheinlich die Bastille nicht gestürmt, hätte Gandhi das Weltreich, in dem die Sonne nicht unterging, nicht herausgefordert, Martin Luther King nicht zum gewaltlosen Widerstand gegen die weiße Übermacht im «Land der Freien und der Heimat der Mutigen» aufgerufen. Sie versuchten nicht, eine vollkommen gerechte Welt zu erstreiten (selbst wenn Einigkeit darüber bestünde, wie sie aussehen würde), sondern sie wollten klares Unrecht beseitigen, so weit sie konnten.
Unrecht zu erkennen, dem man abhelfen kann, ist nicht nur ein Beweggrund für unser Nachdenken über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern auch zentral für die Theorie der Gerechtigkeit – das möchte ich in diesem Buch zeigen. In der hier vorgelegten Untersuchung wird die Feststellung von Ungerechtigkeit oft genug als Ausgangspunkt für kritische Diskussion fungieren.[2] Aber warum sollte sie nicht auch ein guter Endpunkt sein, könnte man fragen.Warum müssen wir über unseren Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hinausgehen? Wozu brauchen wir eine Theorie der Gerechtigkeit?
Um die Welt zu verstehen, reicht es nicht, einfach nur unmittelbare Wahrnehmungen zu registrieren. Zum Verstehen gehört unvermeidlich Nachdenken. Wir müssen «studieren», was wir fühlen und zu sehen scheinen, und wir müssen fragen, was diese Wahrnehmungen anzeigen und wie wir ihnen angemessen Beachtung schenken können, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Eine dieser Fragen bezieht sich auf die Zuverlässigkeit unserer Gefühle und Eindrücke. Das Gespür für Ungerechtigkeit könnte als ein Signal dienen, das uns in Bewegung setzt, aber ein Signal muss kritisch untersucht werden, und eine Schlussfolgerung, die lediglich auf Signalen beruht, muss auf ihre Solidität hin geprüft werden. Adam Smith war überzeugt, dass ethische Gefühle wichtig sind, aber das hielt ihn nicht davon ab, nach einer «Theorie der ethischen Gefühle» zu suchen; er bestand darauf, dass ein Gefühl von Unrecht einer durchdachten kritischen Prüfung ausgesetzt werden muss, damit deutlich wird, ob es Grundlage für eine nachhaltige Verurteilung sein kann. Das Gleiche gilt für die Neigung, jemanden oder etwas zu rühmen; auch sie ist kritisch zu prüfen.*1
Wir müssen darüber hinaus fragen, welche Arten des Vernunftgebrauchs bei der Beurteilung der ethischen und politischen Konzepte von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zum Einsatz kommen sollen. Auf welche Weise kann die Diagnose einer Ungerechtigkeit oder dessen, was sie verringern oder beseitigen würde, objektiv sein? Wird Unparteilichkeit in einem besonderen Sinn verlangt, etwa das Absehen von den eigenen erworbenen Ansprüchen? Ist es auch nötig, gewisse Einstellungen zu überprüfen, selbst wenn sie nicht mit erworbenen Ansprüchen zusammenhängen, sondern ortsgebundene Vormeinungen und Vorurteile spiegeln, die in der durchdachten Konfrontation mit anderen, nicht im gleichen Provinzialismus befangenen Denkweisen vielleicht nicht standhalten? Welche Rolle spielen Rationalität und Vernünftigkeit für das Verständnis dessen, was Gerechtigkeit fordert?
Diese Probleme und einige in engem Zusammenhang damit stehende allgemeinere Fragen werden in den ersten zehn Kapiteln behandelt, und anschließend befasse ich mich mit möglichen Anwendungen der Theorie: mit der kritischen Einschätzung der Grundlagen für Urteile über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit (das können Freiheiten, Befähigungen, Ressourcen, Glück, Wohlergehen oder andere sein), mit der besonderen Relevanz diverser Erwägungen, die in die Rubrik Gleichheit und Freiheit einzuordnen sind, mit dem offenkundigen Zusammenhang zwischen dem Streben nach Gerechtigkeit und dem Verständnis von Demokratie als «Regierung durch Diskussion» und mit der Natur, Durchführbarkeit und Tragweite der Menschenrechte.
Welche Art von Theorie?
Die Überlegungen, die in diesem Buch präsentiert werden, zielen auf eine Theorie der Gerechtigkeit in einem sehr weiten Sinn. Sie soll klären, wie wir verfahren können, wenn wir Fragen der Erweiterung von Gerechtigkeit und Beseitigung von Ungerechtigkeit in Angriff nehmen wollen; sie hat nicht das Ziel, Antworten auf die Frage nach dem Wesen vollkommener Gerechtigkeit zu bieten. Darin unterscheidet sie sich deutlich von den Theorien der Gerechtigkeit, die in der gegenwärtigen politischen und Moralphilosophie das Feld beherrschen. Vor allem drei Unterschiede verdienen besondere Beachtung – in der Einleitung werden sie ausführlicher behandelt.
Der erste Unterschied: Eine Theorie der Gerechtigkeit, die als Basis für den Gebrauch der praktischen Vernunft dienen kann, muss zeigen können, wie tatsächliche Versuche zur Verminderung von Ungerechtigkeit und Beförderung von Gerechtigkeit einzuschätzen sind; sie sollte sich nicht ausschließlich auf die Charakterisierung vollkommen gerechter Gesellschaften konzentrieren, wie es in den Theorien der Gerechtigkeit der politischen Philosophie von heute häufig geschieht. Es gibt Zusammenhänge zwischen diesen beiden verschiedenen Zielsetzungen, aber trotzdem sind sie analytisch voneinander entkoppelt. Das Ziel, auf das sich dieses Buch konzentriert, hat zentrale Bedeutung für Entscheidungen über Institutionen,Verhaltensweisen und andere Determinanten der Gerechtigkeit; und die Ableitung solcher Entscheidungen muss die wichtigste Aufgabe einer Theorie der Gerechtigkeit sein, die als Richtlinie für praxisorientierte Überlegungen dienen soll. Die Behauptung, dass diese vergleichende Arbeit erst möglich sei, nachdem die Aufforderungen der vollkommenen Gerechtigkeit geklärt wurden, diese Behauptung ist nachweislich ganz und gar falsch (im Kapitel 4, «Stimme und kollektive Entscheidung», wird der Nachweis geführt).
Der zweite Unterschied: Manche Fragen der vergleichenden Beurteilung von Gerechtigkeit können zufrieden stellend geklärt werden, und mittels durchdachter Argumente ist dann Einigung zu erzielen, aber es gibt womöglich auch Vergleiche, in denen Meinungsverschiedenheiten über konkurrierende Erwägungen nicht völlig beigelegt werden können. Hier wird die These aufgestellt, dass mehrere verschiedene Gründe der Gerechtigkeit nebeneinander bestehen können, die alle kritischer Überprüfung standhalten, aber zu unterschiedlichen Folgerungen führen.*2 Vernünftige, in entgegengesetzte Richtungen weisende Argumente können von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Traditionen stammen, aber auch innerhalb einer einzigen bestimmten Gesellschaft und sogar in derselben Person vorkommen.**3
Um mit dem Konflikt zwischen einander widerstreitenden Ansprüchen umgehen zu können, brauchen wir eine vernünftige Auseinandersetzung mit anderen und mit uns selbst; die Haltung, die man «bindungslose Toleranz» nennen könnte und die bequeme Lösungen wie «Sie haben Recht in Ihrer Gemeinschaft und ich in meiner» bietet, ist dazu nicht geeignet. Vernunftgebrauch und unparteiische Überprüfung sind entscheidend. Aber auch nach der gründlichsten kritischen Untersuchung können einander widerstreitende und konkurrierende Argumente übrig bleiben, die durch unparteiische Überprüfung nicht auszuräumen sind. Im Folgenden werde ich mehr dazu sagen, möchte aber an dieser Stelle schon betonen, dass die Notwendigkeit des Vernunftgebrauchs und der kritischen Prüfung keinesfalls dadurch in Frage gestellt wird, dass womöglich einige konkurrierende Prioritäten die Konfrontation mit der Vernunft überdauern. Die Pluralität, mit der wir dann enden, wird das Resultat des Vernunftgebrauchs, nicht des Verzichts auf vernünftiges Denken sein.
Der dritte Unterschied: Dass es Ungerechtigkeiten gibt, die sich beseitigen lassen, kann gut mit Übertretungen von Verhaltensregeln zusammenhängen und nicht mit institutionellen Mängeln (Pips in Große Erwartungen geschilderte Erinnerung an die Gewalttätigkeit seiner Schwester war nur dies, aber keine Verurteilung der Institution Familie). Gerechtigkeit ist letzten Endes...









